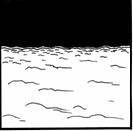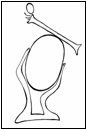Kersten Reich: Methodenlandschaft |
(Text aus den beiden ersten Auflagen der "Konstruktivistischen Didaktik") |
Einen Dialog über Methoden mit Lernenden zu führen, das ist besonders anspruchsvoll. Es ist kein Dialog, sondern Überredung oder gar Manipulation, wenn der Lehrende den Lernern methodische Freiheit z.B. in Gruppenarbeiten oder Projekten suggeriert, dann jedoch methodisch den Unterricht so geplant hat, dass es kaum Abweichungen von seinem Programm geben kann. Ein methodischer Dialog soll hingegen eine gemeinsame Diskussion über wünschenswerte, gehbare und erfolgreiche Wege des Lehrens und Lernens beinhalten, wobei der Lehrende durchaus mit seinem Wissen und seinen Erfahrungen in diesen Dialog eintritt. Aber er spielt dieses Mehrwissen nicht besserwisserisch gegen die Lerner aus, sondern sucht mit Begründungen und Vorschlägen im Gespräch zu überzeugen. Einen solchen Dialog erlernt man am besten dadurch, dass der Lehrende mit den Lernenden ein positives Beispiel für einen Dialog setzt, d.h. ein Gespräch zu führen, das nicht bloß aufgesetzt wirkt, in dem eine hohe Wertschätzung für die Meinung des anderen zu spüren ist, in dem offen kommuniziert wird. Der Lehrende muss es dabei verstehen, zwischen den Rollen der Moderation, der Ironie und des fachlichen Engagements eine Balance zu finden, die für den Dialog förderlich ist. Eine solche Balance wird in unterschiedlichen Gruppen situativ unterschiedlich gefunden werden müssen. Nachfolgend will ich eine Einführung für diejenigen geben, die Methoden (nach eigenen Unterrichtserfahrungen) bisher eher als eindeutige Techniken des Lehrens und Lernens gesehen haben, oder für die, die meinen, dass man mit Methoden bloß Wege bezeichnet, auf denen wir etwas besonders effektiv erreichen können. Beiden Wünschen will ich verdeutlichen, dass Methoden ein schwieriges, kompliziertes und situatives Feld von Perspektiven und Handlungen, von Beobachtungen und Kommunikationen beinhalten. Methoden sind nicht bloß Formen des Handelns, es sind keine Techniken, die man einmal so und dann anders einsetzen kann, sondern im Lernen und Lehren sind Methoden in einem zusammenhängenden Gefüge zu betrachten. Dabei gibt es in der didaktischen Geschichte unterschiedliche Beobachtungsweisen, um dieses Gefüge zu erfassen. Schon bei Pestalozzi finden wir den Hinweis darauf, dass Kopf, Herz und Hand im didaktischen Handeln zusammenwirken. Es gibt für das lehrende oder lernende Subjekt keine einfache Lösung, etwa nur auf den Kopf, das Herz oder die Hand zu schauen. In neueren Ansätzen stellt man oft die Sache (Aufgabe), den Lerner und den Lehrenden in ein Dreieck, um zu markieren, dass die Methoden des Lernens und Lehrens in unterschiedliche Richtungen weisen: vom Lerner zum Stoff und zum Lehrer, vom Stoff zum Lerner und Lehrer, vom Lehrer zum Lerner und zum Stoff. Erst wenn alle drei Beziehungen beachtet werden, wird das Lernen erfolgreich sein können, so lautet die bekannte These. Die konstruktivistische Didaktik knüpft an die eben geschilderte ganzheitlich orientierte Sichtweise an und erweitert ihren Horizont. Um dies zu verdeutlichen, will ich von einer Methodenlandschaft sprechen, die wir uns imaginieren können. Eine solche Imagination will ich bewusst bildlich ausdrücken, in eine symbolische Form umsetzen, um so mittels Metaphern Perspektiven des methodischen Beobachtens, Teilnehmens und Handelns zu beschreiben. Das Bild, das ich entwerfe, soll dabei eine Landschaft darstellen, deren Erscheinungen sich ständig ändern, obgleich es auch einige über längere Zeit gleich bleibende Orte und Perspektiven gibt. Aber die Orte sind bereits von Menschen konstruierte Plätze und mit bestimmten Namen versehen. Diesen gegenüber haben wir eine Freiheit. Die Ausblicke können uns in Stimmungen versetzen, sie können uns anregen und interessieren, aber auch flüchtig und unbestimmt bleiben. Ich werde nachfolgend einige Aspekte und Perspektiven angeben, die in einer solchen Landschaft vorkommen können. Ganz gleich wie fantasievoll in Teilen solche Landschaften ausfallen, es sind Landschaften, die bereits perspektivisch festgelegt sind, kultivierte Landschaften, die – so wie Landschaften in unseren Wirklichkeiten – von Kultur durchzogen und beschnitten sind. Didaktische Landschaften sind ebenfalls Kulturgebilde, sie entstehen nicht naturhaft und auch nicht ohne menschliche Konstruktionen. Insoweit ist jede dieser Landschaften immer auch im Übergang zu einer Karte, die uns zeigt, was es gibt und was wir finden können. Aber keine Landschaft ist je vollständig, auf einen Blick können wir niemals alles erfassen und wir bleiben auch in meinem Bild in einer unvermeidbaren Oberflächlichkeit – aber vielleicht gelingt auch ein erstaunter Blick. Wenn Sie dem hier vorgeschlagenen didaktischen Ansatz folgen wollen, dann malen Sie imaginär oder tatsächlich für sich ein eigenes Bild und bringen Sie dabei z.B. folgende oder noch weitere Aspekte (nach Ihrer Vorstellung) in dem Bild, das ich als meine Version beispielhaft darzustellen versuche, unter:
In der konstruktivistischen Methodenlandschaft gibt es zahlreiche Wege der Konstruktion. Auf ihnen wandern wir als Akteure, wenn wir handeln, uns auf bestimmte Aktionen einlassen, die vorgegebene Bahn befolgen oder verlassen. Auf ihnen beobachten wir, was geschieht, wie etwas geschieht und welchen Sinn es macht. Wir nehmen teil, indem wir mit anderen über diese Wege gehen und mit bestimmten Verständigungen und Ein- oder Aussichten handeln. Auch wenn wir meist nur einen Weg beim Durchschreiten dieser Landschaften in den Blick nehmen können und bestimmte Methoden wählen, mit denen wir uns etwas beibringen oder erfahren wollen, so wissen wir, dass es unzählige Wege in verschiedenen Landschaften gibt. Die Methoden, die wir im Lernen einsetzen, lassen sich nicht abschließen oder auf wenige erfolgreiche reduzieren. Dennoch wiederholen sich in kultivierten Landschaften bestimmte Blicke und Erwartungen. Konstruktive Wege sind unsere Chance, etwas für uns zu lernen, weil wir eigene Wege gehen. Damit eröffnen sich uns Erfahrungen. Sie bieten die Möglichkeit, als Akteur (learning by doing), als Teilnehmer (Verständigungen über die eigenen Voraussetzungen), als Beobachter (sich und andere sehend und reflektierend) zu lernen. Methodische Experimente erschließen neue Wege, wir wagen uns ins Gelände. Das Risiko besteht allenfalls darin, die eigenen Erfindungen gegenüber den Möglichkeiten von Entdeckungen zu überschätzen. Wir könnten mit unseren Methoden scheitern. Aber wir werden auch keine Freude an Entdeckungen anderer haben, wenn wir sie nicht teilweise für uns nacherfinden. Daher benötigen wir vor allem Methoden, die unsere eigene Suche, unseren eigenen Findungs- und Erlebensprozess stärken. Methoden, die uns überwiegend vorschreiben oder nachzeichnen, was andere von uns wollen, gehören zwar auch zur Kultur unserer Landschaft, aber sie haben im Laufe der Zeit ihre bestimmende Position verloren. So sind die Wege zahlreicher und vielfältiger geworden.
Immer wieder kommen wir auf unseren konstruktiven Wegen an den Häusern der Rekonstruktion vorbei, gehen in sie hinein, verlieren uns in den vielen Zimmern, den hohen Anforderungen, der umfangreichen Bibliothek, verschlungenen Gängen und Treppen und sehen aus manchen Fenstern hinaus. Beim Blicken aus den Fenstern sehen wir z.B. die Ruinen der Dekonstruktion, die aufgegebenen und verlassenen Häuser, die immer mehr zerfallen, aber auch weite Ausblicke auf das Meer des Begehrens, die unsere Wünsche in die Ferne schweifen lassen. Was wäre, wenn wir auf Dauer in diesen Häusern der Rekonstruktion blieben? Hier hätten wir nur sehr kurze Wege und kaum ein Risiko wie im Freien. Wir hätten einige Chancen: Unsere Studien ließen sich vertiefen und theoretisch ausgestalten. Wir könnten unser Denken in alle Richtungen ausprobieren und all die Bücher studieren, die noch ungelesen auf uns warten. Es gibt hier so vieles zu lernen und wir könnten uns in all die symbolisierten Möglichkeiten der Hausbibliothek vertiefen. Unsere Blicke und Aussichten würden eine große Gewissheit erlangen, denn aus einem Haus kann man immer auf die gleiche Landschaft im Wechsel der Zeiten sehen. Aber das Risiko liegt darin, dass wir so von unserer Landschaft nur einen Teil als Beobachter erfahren würden, wir wären eingesperrt und Gefangene eines Wissens mit großer Vergangenheit, das bloß aufbewahrt worden ist. Und woher sollen wir Anstöße für unser Lernen bekommen, woher sollen wir wissen, was wichtig für unser Leben ist, wenn wir denn einmal dieses Haus verlassen? Unsere Methoden des Lernens blieben begrenzt. Da wir heute kaum noch jemanden finden, der unser Leben auf Dauer in diesem Haus finanzieren wird, da wir dies mehrheitlich aber auch gar nicht wollen, müssen wir hinausgehen: auf die vielen konstruktiven Wege. Wenn wir hinausgehen, so können wir immerhin vieles, wenn auch nicht alles, aus diesen Häusern in unsere Teilnahme (unser Verstehen), in unsere Beobachtungen und Handlungen mitnehmen, besonders das, was wir als Ideen, Texte, Einsichten tragen können und wollen. Insoweit werden wir auch ständig diese Häuser wieder aufsuchen, weil wir nie alles auf einmal tragen und behalten können. Und es wird spannend bleiben, ob wir das nächste Mal wieder genug Ideen und Material finden können, um uns anregen und Lösungsmöglichkeiten aufspüren zu lassen.
Wie vergänglich Dinge, Probleme, Lösungen aus der Vergangenheit sind, dies sehen wir an den zerfallenen Häusern, die neben den noch bewohnten der Rekonstruktion stehen. Die Ruinen der Dekonstruktion sind für manche besonders spannende Gebäude, weil sie zum Spielen reizen, weil manches Abenteuer in ihnen lauert, weil sie als offen, unvollkommen, rätselhaft erscheinen können. Hier wachsen die Chancen der Auseinandersetzung, der Kritik, der Überwindung von Zuständen, die sich überlebt haben, hier erhält der Beobachter einen Eindruck von der Unzeitgemäßheit der alten Dinge, aber auch von der Vergesslichkeit, dem Übersehen, wenn sich das Alte als durchaus gar nicht veraltet zeigt. Hier sieht der Beobachter vielleicht eine Wiederkehr des ewig Gleichen. Auf unseren Wegen der Konstruktion, auf den Gängen zwischen rekonstruktiven Häusern und dekonstruktiven Ruinen, überqueren wir immer wieder systemische Brücken. Sie verbinden unsere Wege, unterbrechen sie, lassen uns über manches wilde Gewässer sicher schreiten. Solche Brücken stehen oft nahe an den Klippen des Scheiterns. Auf den konstruktiven Wegen gibt es manche Schwierigkeiten, denn der gerade Weg, der mühelos gegangen wird, gilt für das Lernen in der Regel nicht. So muss manche Brücke auch erst im Gehen gebaut werden, um Hindernisse zu überwinden und Abstürze zu vermeiden. Brücken symbolisieren in der methodischen Landschaft jene Verständigung über Kommunikation, Partizipation, über alles Gemeinsame und dialogisch Ausgehandelte, über die Beziehungsseite, die uns beobachtende und verstehende Verbindungen zu allen Inhalten und zum Miteinander schlagen lassen. Ohne solche Brücken könnten wir keine längeren Strecken gemeinsam gehen. Eine systemische Beobachtungs- und Denkweise eröffnet uns Chancen, Beziehungen und Inhalte in ihrem Zusammenwirken, in ihren Wechselwirkungen und Kontexten zu sehen. So können wir Ressourcen erkennen und Lösungen für Probleme finden. Das Risiko, dass so alle Sicht- und Denkweisen komplexer, schwieriger, anstrengender werden, müssen wir dabei in Kauf nehmen. Die Brücken sind menschliche Kunstwerke, die als Methode uns auch schwierige Passagen in gangbare Wege verwandeln: Mitunter genügt ein Holz über einem Fluss, um ihn sicher zu überqueren, wenn wir balancieren lernen, mitunter bemerken wir vielleicht aber auch gar nicht, dass wir über eine Brücke gegangen sind, die schon seit langer Zeit auf dem immer wieder durchschrittenem Wege steht. Je mehr wir allein und einsam sind, desto schwerer wird es uns, Brücken zu bauen oder sichere Übergänge zu finden. Die Brücken hingegen, die wir gemeinsam mit anderen gebaut haben, werden uns als ein bleibender Wert und ein Gefühl begleiten: Mag es auch noch so schwierig auf unseren Wegen sein, es ist überall möglich, gemeinsam Lösungen für Übergänge zu (er)finden.
In unserer Landschaft machen wir immer wieder Halt auf methodischen Hügeln, die von konstruktiven Wegen durchzogen sind. Ausblicke von jedem dieser Hügel bieten neue Sichten, andere Perspektiven, und einmal mögen wir den einen Hügel lieber als einen anderen, ein nächstes Mal wechseln wir unsere Gewohnheiten, weil wir zwischendurch auf den konstruktiven Wegen neue Erfahrungen und Erlebnisse gemacht haben. Die Hügel versinnbildlichen einst erfolgreiche Methoden. Sie wurden irgendwann einmal unter dem Gesichtspunkt einer bestimmten Aussicht gefunden. Einige sind mühsamer zu besteigen, manche sind abgelegen, andere an fast vergessenen Orten. Dies liegt daran, dass die Methoden in Hinsicht ihres Erfolges nie gleich bleiben, sie ändern sich mit der Zeit und mit jenen, an die sie sich richten. So gibt es gewohnte und unvertraute, beachtete und vergessene Methoden in der Landschaft. Und manche entdecken wir erst nach und nach, vielleicht sind wir zuvor sogar unachtsam an ihnen vorübergegangen. In keiner der Methodenlandschaften können wir heute erwarten, den letzten und besten Hügel zu finden (früher hat man diesen sehr gerne gesucht und zu finden unterstellt), auf dem wir auf Dauer verweilen wollen, auch wenn wir immer noch Lieblingsplätze finden mögen. Aber was würde geschehen, wenn wir solche Plätze bloß aus Bequemlichkeit einnehmen und die konstruktiven Wege, die zu anderen Aussichten führen, nicht mehr gehen? Durch unsere Bequemlichkeit und unser Verweilen auf bestimmten Hügeln würden wir anderen Beobachtern, Teilnehmern und Akteuren an unserer Seite nur eine begrenzte Aussicht eröffnen können. Über kurz oder lang fahren sich dann unsere Perspektiven fest und wir langweilen uns und andere im immer gleichen methodischen Bild. Gegenüber früher hat sich die Suche nach geeigneten Methoden geändert: Aus dem Wunsch nach der einen Aussicht, nach der einen gültigen und eindeutigen Perspektive, um Ordnung in die Dinge und Welt zu bringen, ist in der Welt die Aussichtslosigkeit entstanden, alle Menschen auf diese eine Sicht begrenzen und beschränken zu wollen oder zu können.
Die Wiesen des Ideenreichtums können an den konstruktiven Wegen und auf den methodischen Hügeln große Flächen einnehmen. Im Frühjahr sind sie besonders schön und voller unterschiedlicher Blumen. Sie regen alle Sinne an und locken uns, ein wenig zu verweilen. Hier spüren wir nicht mehr die Suche nach einer nur rationalen Ordnung, hier haben wir glückliche Gefühle, die unsere Wünsche und Ideen begleiten. Wir sind dennoch auf dem Boden und müssen gleichwohl nur ein wenig den Kopf drehen, um den Himmel zu sehen. Haben wir Lust, uns methodische Blumen zu suchen, wiederkehrende oder seltene, um einen Strauch mit nach Hause zu nehmen oder zu verschenken?
Der Himmel des Imaginären zeigt die Vielfalt der Wünsche, die sich im Horizont unser Vorstellungen bilden. Hier existiert ein vorsprachlicher Raum. Es erscheinen Bilder, Wünsche, Sehnsüchte, Visionen, die von einem Begehren oft ungewusst und unbewusst geleitet sind, die wir spüren, empfinden, erleben, und die so viel freier, unbefangener, träumerischer als jene erscheinen, die auf festem Boden, in der Sprache und rationalen Verhandlungen, im Geschriebenen, Beschlossenen, Gebauten liegen. Was wäre unser Leben ohne einen imaginären Himmel? Ein Blick in die Höhe kann uns zeigen, wohin wir noch gelangen könnten. Werden wir uns Risiken des Absturzes imaginieren, um in dem zu bleiben, was wir kennen? Oder werden wir hinreichend Blicke riskieren, um uns neue Chancen vorzustellen? Und werden diese Blicke uns antreiben, es dann auch praktisch zu versuchen, ein wenig vom Himmel auf die Erde zu holen? Werden wir Erfinder von Methoden sein können, die uns dabei helfen? Methodische Künstler, die am Imaginären teilhaben? Haben wir ein Begehren in uns, das uns antreibt, didaktische Künstler zu werden und methodische Landschaften zu malen?
Das Meer des Begehrens ist tief und weit. Kein Beobachter kann sagen: „Sieh, ich habe in mich geschaut und alle Tiefen meines Begehrens entdeckt.“ Das Begehren verweigert sich, denn es hat Seiten, die wir nicht kennen, Tiefen, die wir noch nicht erkundet haben, es ist ein Medium, in dem wir schwimmen, ohne es je in unseren Händen festhalten zu können. Es ist uns Weite, wenn wir an seinem Ufer sitzen, Sehnsucht, wenn es einmal fern ist, Erleben und Erleichterung, wenn wir in ihm sind. Ein Beobachter wäre dumm, wenn er verlangen würde: „Bilde mir dein Meer des Begehrens vollständig ab, sage mir, was es alles ist und wie du es effektiv nutzen kannst!“ Ein Meer, so antworten wir, wenn wir durch zahlreiches Schauen, Sehnen und Schwimmen klug geworden sind, verweigert sich solchen Zugriffen. Es ist auch methodisch nicht planbar, sondern Antrieb und Grenze. Für diesen Antrieb oder diese Grenze tragen wir einen Blick in uns, der entweder weiß, was er am liebsten sehen will (diese Gewohnheit kann auch zu einer liebenswerten, wenngleich beschränkenden Gefangenschaft werden) oder wünscht, anders als bisher zu sehen (und sofern dieser Wunsch nicht durch Ängste verstellt wird, entsteht gerade hier die Offenheit für ein Lernen des Neuen).
Die Wellen der Begeisterung treiben uns an, erzeugen Schwung und Aufregung, bereiten Spannung und ermöglichen Erlebnisse. Sie sind an den Rändern des Meers des Begehrens am höchsten, dort, wo der Himmel des Imaginären und die Winde der Wahrnehmung aufeinander treffen. Man kann diese Wellen nicht methodisch planen, sie kommen, wie es die Umstände wollen und wenn die Zusammenkunft von Meer und Himmel, von Wind und Wahrnehmung gelingt. Sie bleiben flach, wenn man sich weder Wind noch Wetter, weder Meer noch Himmel stellen will.
Die Klippen des Scheiterns scheinen eine Gefahr und weniger eine Chance zu sein. Doch im Lernen ist es anders als auf einem wackligen Schiff. Im Lernen sind die Klippen deshalb eine Chance, weil der Lerner sein Scheitern nie mit dem Leben, sondern mit einer orientierenden Erfahrung bezahlt. Wer in seinen Methoden nie gescheitert ist, der weiß gar nicht, wann er welche Methoden im Lernen einsetzen soll. Allerdings sollte nie ein Lehrender vorschreiben oder manipulieren, wie ein solches Scheitern geschehen könnte, um eine Lernleistung zu erzwingen, denn dann könnte sich der Lerner aus Trotz verweigern und eigene Klippen gegen das Lernen errichten.
Um das Begehren und das Imaginäre zu spüren, benötigen wir eine Wahrnehmung, die unsere Sinne berührt. Die Winde der Wahrnehmung beflügeln uns, denn in sinnlicher Gewissheit erscheint eine Erfahrung (experience), die uns sehen, fühlen, hören, riechen und schmecken lässt, was uns auf konstruktiven Wegen begegnet, was wir herstellen und benutzen. Eine primäre Erfahrung (primary experience), so stellte schon John Dewey fest, wird uns zum Ausgangspunkt eines direkten Erlebens. Dies ist ein sinnvoller Ursprung aller didaktischer Methoden: Ein unmittelbar spürbares Ereignis zum Ausgangspunkt zu nehmen. Dann denken wir nach, verweilen, unterhalten uns, reflektieren (secondary experience). Allerdings ist die Wahrnehmung damit nicht zweistufig, sie ist nicht einfach nach ursprünglich oder natürlich und abgeleitet zu unterscheiden. In jede Wahrnehmung – auch in primäre Erfahrungen – sind immer schon Interpretationen eingegangen und die Wahrnehmung selbst kann uns nicht sagen, wie wirklich die Wirklichkeit ist, die wir da sehen. Auch Fiktionen und Virtualisierungen werden von uns auf konstruktiven Wegen unmittelbar und direkt sinnlich wahrgenommen und erzeugt, ja, sie treten zunehmend an die Stelle einer vormals in der Natur erworbenen Wahrnehmung. Es wird für Menschen im Zivilisationsprozess heute immer wichtiger, die subtilen Unterschiede zwischen direkten und indirekten, fiktiven und tatsächlichen, vor Ort stattfindenden und virtuellen, symbolischen und imaginierten, nachprüfbaren und halluzinierten Ereignissen zu beobachten und zu reflektieren. Die Wirklichkeiten bilden sich nicht einfach in uns ab, wir haben keine höheren Schiedsrichter oder unumstrittene Experten, die uns von außen die objektiv abgebildete Wahrheit unserer Wahrnehmungen verkünden können. Deshalb benötigen wir schon als junge Lerner Methoden, die uns eine prüfende, abwägende, nach vielen Seiten schauende und miteinander darüber kommunizierende Arbeit der Unterscheidung von Wirklichkeiten erleichtern: Besonders was wird wie gesehen, von wem, mit welchen Zwecken, in welchem Kontext? Diese Fragen bedeuten, dass auch Konstruktivisten unterschiedliche Grade der eher direkten oder indirekten, der fiktiven und tatsächlichen, der vor Ort erfahrenen oder virtuellen, symbolischer oder imaginierter, nachprüfbarer oder halluzinierter Wahrnehmungen in der beobachteten, der teilnehmenden und handelnden Realität unterscheiden. Wir wollen solche Unterscheidungen treffen, um unsere Orientierungen zu finden und zu erleichtern. Dabei wollen wir ohne Beunruhigung eine eher subjektiv empfundene und erlebte Wirklichkeit von einer eher mit anderen geteilten, objektivierten und anerkannten Wirklichkeit unterscheiden, die auch nachprüfbar und nachvollziehbar durch andere anerkannt werden kann. Das Risiko besteht darin, dass es zum Konflikt und Streit zwischen dem subjektiven Erleben (= dies ist meine Wirklichkeit bzw. mein „Ich-will-Standpunkt“) und den objektiven Anerkennungen (= dies gilt als objektive Realität bzw. als „Ich-soll-Standpunkt“) kommen kann. Beide Richtungen können uns in der Wahrnehmung an die eine oder andere Stelle treiben, und die Winde, die dies veranlassen, sind unterschiedlich stark. Aber muss es heute nicht zu den wichtigsten methodischen Grundsätzen gehören, ein solches Risiko stets zu wagen? Besteht so nicht die große Chance, nicht nur nach Methoden zu suchen, die uns etwas wahrnehmen lassen, sondern auch nach solchen, die uns in ein von uns mit Sinn erlebtes vertiefendes Gespräch über unsere Wahrnehmungen führen? Allein ein solches Gespräch wird uns helfen können, aus der egoistischen Rechthaberei unserer Wahrnehmung, die wir gegen und über andere stellen, herauszukommen, ohne damit einen Anspruch auf individuelle Sicht abgesprochen zu bekommen.
In den Wahrnehmungen sind wir frei, aber das, was wir wahrnehmen, ist vielfach bereits eine feste Ordnung. Die Städte der Institutionen, die für solche materialisierte Ordnung stehen, bergen oft Häuser der Rekonstruktion, manche schon alt, andere noch neue Bauten, mitunter auch Ruinen neben eben neu Erbautem. In diesen Städten wachsen materialisierte Perspektiven und Bürokratien, die unsere Methoden auf ihre Sicht beschränken: Fest gefügt stehen die Gebäude, unveränderlich erscheinen die Besitztümer und die Aufteilungen, geordnet die Wege und der Verkehr, ewig gleich die Bürokratien, dagegen zunehmend beschleunigt die Abläufe und geregelt die erwünschten Dienstleistungen und Kommunikationen. Es ist wenig Platz für Wälder und Höhlen, für Wiesen und Weite, und auch das Meer und der Blick auf den Horizont liegt in der Ferne. Aber der dichte Raum bietet schnelle Zugänge, viele Annehmlichkeiten, strukturierende Ordnung und jegliche Art von Arbeit, Unterhaltung und Ablenkung. Resultate zirkulieren in Formen ökonomischen, symbolischen, sozialen und kulturellen Kapitals durch die Adern der Städte. Hier gibt es den meisten Raum zum Lernen in Gebäuden, die wie Kasernen aussehen, aber die Räume zum konstruktiven Spielen sind auf bloß noch wenige Plätze beschränkt. Und jene, die in diesem System und Aderwerk nicht richtig funktionieren, erscheinen im Straßenbild als gescheiterte Figuren. In der Methodenlandschaft symbolisieren solche Städte das, was an materialisierter Ordnung entstanden ist, was konstruiert wurde und nun als Konstrukt in unsere Möglichkeiten zurückkehrt: Wir wohnen nicht überwiegend in den Wäldern oder in einem unberührten und natürlichen Land, sondern sind an den Erfolg unserer Städte gebunden. Dieser Erfolg kehrt für das Lernen vor allem als Bürokratie zu uns zurück. Es gibt erwartete und erwünschte Methoden, die sich mit dem Erfolg der Zivilisation besonders ausbreiten. Sie werden in den Städten entworfen, gelehrt, produziert. Sie treten als nützliche, gewohnte und bewährte Verfahren auf, sie sind für Massen ausgelegt und auf Serialität orientiert. Überall erscheinen sie, z.B. als Schulbücher mit scheinbar sicherem Wissen, als Ratgeber mit immer den gleichen Tipps, als die Methode, alles Behauptungen, die immer mehr versprechen als sie halten können, weil so vieles ausgeschlossen bleibt. Je hektischer die Zeit, je schneller der Durchfluss, je entindividualisierter das Lernen, desto mehr wird Lehrenden eine Entlastung aus der Sicht der zivilisierten, vermassten, aufgeklärten Stadt zugesagt: Mit bestimmten Methoden tun wir das, was besonders schnellen Erfolg verspricht. So sind wir auf der sicheren, der professionalisierten Seite, bei dem, was in der Stadt so üblich ist und auch aufs Land getragen wird. Schließlich wohnen fast alle Experten in der Stadt, die deshalb als aufgeklärt und fortschrittlich gilt.
Die Gebirge des Ungewissen zeigen solchen Städten immer die Grenzen am Horizont auf. Es sind institutionelle Regelungen, die uns das Ungewisse zu vernichten scheinen, die aber nur funktionieren, wenn wir in dieser Stadt verweilen und nicht mehr aus ihr heraustreten könnten. Der Reiz, einmal ins Gebirge zu ziehen und von oben auf die kleine, die nichtige Stadt zu schauen, ist aber groß und eine ständige Chance. Wir nehmen die Risiken beschwerlicher Wege auf uns, um in den Genuss einer Distanz zu kommen. Nah sieht, wer von Ferne sieht, so verkündet eine alte Weisheit, die auch eine methodische Weisheit im Lernen ist. Und das Ungewisse eröffnet uns Kreatives, Spannung, Neugierde, Experimente, so vieles, was ein Scheitern in der Suche nach klaren Wegen oder eindeutigen Antworten entschädigt, das wir in diesem Gebirge riskieren. Methodische Arbeit erscheint in diesem Gebirge im Bilde des Sisyphos: Wir versuchen immer wieder aufs neue, einen Stein den Berg hinaufzurollen, um ihn am Ende hinunterfallen zu sehen. Wir planen und beschreiben, wir erwarten und verlangen, um das Lernen methodisch zu regieren, aber das erreichte Ereignis begrenzt und unterläuft, es gestaltet um und verändert. Was uns immer bleibt, dass ist die Mühe und der aufrechte Blick, wenn wir etwas geschafft haben, auch wenn es im nächsten Moment ganz anders gekommen ist und alles von vorne anzufangen scheint. Als didaktischer Sisyphos haben wir jedoch den wissenden und ironischen Blick, der das Lernen als eine Möglichkeit sieht, selbst schwerste Steine zu bewegen, auch wenn wir nicht direkt und eindeutig planen können, wohin sie rollen werden und was sie anrichten können. Und wir sehen die Lerner neben uns, die ihre Steine rollen, und reden über ihren ironischen Blick, wenn ihre Steine sich ähnlich verhalten wie unsere. So geschieht es uns, wenn wir gemeinsam ins Gebirge gehen und uns unterhalten.
Das Tal der Gewissheiten liegt vor der Stadt der Institutionen und dem Gebirge des Ungewissen. Es ist der Ort, wo die eindeutigen Wahrheiten liegen. Wer hier länger verweilt, für den vereinfacht sich die gesamte Welt. Das Tal ist von zahlreichen Wegen durchzogen, die durch die flache Landschaft gehen. Und die kürzeren Wahrheiten sind in Sand geschrieben oder als länger dauernde in Stein gemeißelt. Jedes feste Zeichen und Symbol scheint unverwüstlich. Doch die Zeiten lassen auch in diesem Tal nichts unverändert. Der Wind weht die Schriften weg, das Wasser lässt die gemeißelte Schrift verwittern, und immer neue Wanderer oder Einsiedler, Bewohner des Tals, erzeugen neue Zeichen und Symbole und überschreiben alte. Das Tal beherbergt auch die Plätze methodischer Gewissheiten. Es sind dies Plätze, wo die Wahrheit von einigen Wanderern oder Einsiedlern besonders reich verkündet wird, aber der sinnliche Reichtum besonders arm ist: Sie sprechen über, sie verkünden von, sie beschreiben und bieten allerlei Zeichen und Symbole an, ohne jedoch aus dieser Gewissheit ins Leben zurückkehren oder vom direkten Erleben handeln zu können. So muss der methodische Wanderer erkennen, wenn er nicht auch ein Einsiedler letzter Gewissheiten werden will, dass das Tal immer nur zu durchstreifen ist, um woanders hin zu gelangen.
Dies liegt auch daran, dass im Tal die Felder der Routinen liegen. Sie werden oft hinter oder neben den Häusern der Rekonstruktion und in der Nähe der Städte der Institutionen angebaut, sie sind so schneller und leichter als das Gebirge zu erreichen. Sie zeichnen sich durch Gleichmäßigkeit und Wiederkehr aus. Es mag ermüdend erscheinen, sie immer aufs Neue zu bestellen und doch nur eine scheinbar gleiche Ernte einfahren zu können, und dennoch bieten sie uns Nahrung, die wir alltäglich benötigen. Solche Felder zu bestellen und aus ihnen Nahrung zu gewinnen, ist im Lernen dann wichtig, wenn wir Handlungen automatisieren und so antizipieren wollen, dass es auf gleich bleibende Reaktionen ankommt. Wenn wir nach einem Schema oder Muster, das sich bewährt hat, vorgehen, dann suchen wir diese Felder auf. Hierfür gibt es Methoden, die früher fast immer bevorzugt wurden: Etwas auswendig lernen, etwas nachmachen, etwas definieren, etwas nachempfinden, insgesamt etwas übernehmen, das uns vorgegeben ist. Aber ein Erfolg gelingt nur, wenn wir diese Routinen akzeptieren und sie wollen. Und wir müssen das Risiko eingehen, eine immer gleiche Lösung für Ereignisse zu verwenden, obwohl sich die Ereignisse vielleicht schon längst gewandelt haben, so dass unsere Lösungen unpassend geworden sind. Die Felder der Routinen tragen selbst bei gutem Einsatz noch einen weiteren Mangel: Sie sehen sich nach längerem Hinsehen fast alle ähnlich und dort, wo wir anfänglich Ruhe und Ordnung fanden, sehen wir mit Abstand nun Langeweile und Missvergnügen. So müssen wir Ausflüge an andere Orte machen, um überhaupt Lust entwickeln zu können, die Felder immer aufs Neue zu bestellen. Also doch ins Gebirge gehen? Oder an andere Orte?
Ein Ausflugsort ist der Wald der Wagnisse, der weit entfernt von ihnen liegt. Von Gewohnheiten abzuweichen, einmal Neues zu probieren, sich auf dunkle und unerschlossene Wege einzulassen, sich der Natur und ungeschützten Plätzen zu stellen, kein Durchkommen zu finden und sich zu verlaufen, dies alles ist Wagnis und neue Möglichkeit. In den Routinen fragen wir schnell nach Nutzen und Gewinn, im Wald der Wagnisse gelten diese Nützlichkeiten und Gewinne nichts. Hier verlieren sich alle Wege in Unwegsamkeit, damit in Möglichkeiten, in allen Richtungen voranzugehen und sich neu zu entdecken. Es fehlen die weiten Aussichten des Gebirges, hier wird langsam und kleinen Schrittes gegangen. Es gilt im Kleinen noch viele Methoden zu finden, die wir im Wald der Wagnisse erfahren können. Das Risiko des Verlaufens oder Verweilens an nebensächlichen, aber schönen Orten, ist hier Prinzip und selbst ein Scheitern wird zum Erfolg, etwas Neues zu finden. Hier entdecken wir ein wesentliches methodisches Prinzip: Methoden bezeichnen Wege, die wir gehen können, und daher können Methoden eigentlich nicht scheitern. Allein wir, die wir gehen und einen bestimmten Erfolg erwarten, können scheitern, wenn wir für das Bestimmte, das wir suchen, unpassende Methoden wählen. Aber um herauszubekommen, was erfolgreich ist, dafür müssen wir immer Wagnisse eingehen.
Es gibt allerdings Wagnisse und Gebirge, die uns etwas verbergen, die uns Grenzen aufzeigen. Die Höhlen des Unbewussten sind jene Orte, von denen wir ahnen, dass es sie gibt, die wir aber nicht erforscht haben, weil wir ihren Zugang nicht kennen. Sie erscheinen uns als eine Metapher für etwas Erwartetes, denn wir ahnen, dass es verborgene Orte gibt, das aber unserer Reflexion bisher nicht hinlänglich zugänglich war. In solchen Höhlen hausen Stimmen, die uns einreden, dass wir diesen Menschen sympathischer als einen anderen finden, dass wir diese Handlung mit Lust und jene mit Widerstand erleben, dass wir die eine Methode mögen und eine andere als schwierig empfinden. Wir sollten den Eingang suchen und die Höhle ein wenig erkunden, indem wir mit anderen darüber sprechen, selbst Erfahrungen mit uns machen und durch andere spiegeln lassen, um nicht zu sehr in methodischen Gewohnheiten auch ein Ungewusstes zu pflegen, das bloß das wiederholt, was wir in unserer Schulzeit schon gelernt haben. Gleichwohl müssen wir anerkennen, oft Dinge zu verspüren und Handlungen zu agieren, die wir allenfalls nachträglich interpretieren können, ohne immer zu einer eindeutigen Lösung zu gelangen. Dies Ungewusste oder Unbewusste steckt vor allem in den methodischen Bevorzugungen, die wir machen. Eine neue Perspektive werden wir hieraus ziehen, wenn wir mit anderen über diese Eigentümlichkeiten und Rätsel sprechen.
Der Horizont des Realen erscheint uns immer wieder, um jene Grenze zwischen der festen Welt, auf der wir stehen und gehen, von der luftigen Höhe zu unterscheiden, die zu leicht für unser Dasein ist. Wir können uns diesem Horizont zuwenden, auf ihn zugehen, aber er wird immer unerreichbar bleiben. Aus diesem Horizont treten Ereignisse in unser Leben, die wir nicht alle voraussagen und kontrollieren können. Wir haben Gewissheiten über diesen Horizont uns errichtet, z.B. dass in ihm die Sonne auf- und untergeht, dass so manches tagein und tagaus wiederkehrend geschieht, und unser Leben hat es über die Menschheitsgeschichte hinweg zu immer größerer Ordnung und Wahrscheinlichkeitsrechnung gebracht. Aber es bleibt ein Zweifel und auch ein zweifelndes Wissen, denn dieser Horizont des Realen als Möglichkeit unvorhergesehener Ereignisse verschwindet nie, es ist deshalb auch nicht zu bestimmen, was alles in unserer Methodenlandschaft und anderswo noch kommen kann.
Das Bild der Landschaft scheint mir offen genug, um auch einer Ironikerin Raum zu geben. Aber was machst du, wenn jemand diese Metapher einer Landschaft realistisch auffasst? Er würde dann denken, dass es eine Art Natur der Methoden gibt. Aber genau das willst du ja nicht. In deiner Landschaft gibt es Städte, Wege, Häuser, Gebirge, Klippen, Höhlen, Meer und Himmel nur, um ein Bild zu malen, das uns bloß anregen soll, eigene methodische Konstruktionen zu erfinden. Wer dies nicht versteht, der würde sich einen ironischen Blick zuziehen, weil er eine Fantasie mit einem Abbild verwechselt. Eine Metapher hat darin ihren Sinn, uns eine Analogie zu bilden, die kein Abbild darstellt. Wir haben weiter in der „Konstruktivistischen Didaktik“ (ab 3. Aufl.) bereits die Problematik didaktischer Abbilder diskutiert (vgl. Kapitel 5.1). Die Methodenlandschaft ist durch und durch konstruiert. Darin ähnelt sie in einigen Aspekten sogar unseren tatsächlichen Landschaften, die zunehmend konstruierte Territorien darstellen, in denen durch Architektur, Stadt- und Regionalplanung, strukturierte und gepflegte Landschaftsgestaltungen, Parzellierung, Verkehr, Werbung, und vieles andere mehr Symbolisierungen schon direkt eingeschrieben und visualisiert sind. So ist es auch mit den Methoden. Menschen haben sie konstruiert und ihnen ein Territorium im tatsächlichen Leben (zumindest der Schulklassen und anderen Lerninstitutionen) zugewiesen. Dann haben Menschen auf dieses Territorium geschaut und abzubilden versucht, was sie sehen. So erschien es ihnen, als seien Methoden in der Natur selbst vorhanden. Sie haben vergessen, dass es sich um Konstrukte handelt. Methoden des Lernens aber sind von Menschen erfundene Wege, die beschreiben sollen, wie in welchen Situationen gelernt wird. Als solche Konstrukte erscheinen sie auch in meiner Methodenlandschaft.
Was heißt das für die Praxis? Ich wünsche mir in jeder Lerngruppe ein Bewusstsein für eine Methodenlandschaft, denn dies kann die Fantasie in der Suche nach eigenen erfolgreichen Wegen des Lernens über die Befolgung methodischer Regeln anregen. Zugleich hätte ich aber auch gerne eine methodische Überblickskarte, die alle Methoden bezeichnet und angibt, welche Schätze wir dort finden. Kannst du mir eine solche Karte geben? Die hier skizzierte Methodenlandschaft können sich Lerngruppen (in unterschiedlichen Variationen) z.B. an die Wand hängen, um immer wieder neu ihre möglichen Wege und sinnvollen Regeln zu diskutieren. Dabei können zwei Varianten besonders hilfreich sein:
Eine methodische Überblickskarte kann auch hilfreich sein (vgl. die Übersicht im Methodenpool). Dabei lege ich allerdings Wert darauf, solche Karten oder Übersichten immer im Kontext mit methodischen Prinzipien zu sehen, die den Fokus der Methodenauswahl bestimmen. |
|