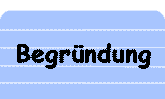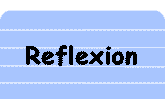3.
Theoretische und praktische Begründung
>>
3.1. theoretische Begründung
>> 3.2. prakttische Begründung
3.1. Theoretische Begründung
Frontale Unterrichtsformen wie das Vormachen, Vorzeigen, Vortragen haben eine lange Tradition. Im Abendland ist hier insbesondere die Predigt maßgebend gewesen, die eine kommunikative Einbahnstraße mit strikter Hierarchie darstellte. „Wahrheiten“ wurden hier nicht diskutiert, sondern verkündet. In China hatte der Konfuzianismus dagegen zwar zwischen Lehrern und Schülern ähnlich wie die griechische Antike unter den freien Bürgern ein dialogisches Verhalten selbst bei Vorträgen des Lehrers eingeführt, aber in der gesellschaftlichen Praxis einer feudalen Gesellschaft ebenso wie in der Sklaverei der Antike galten die Freiheiten ohnehin nur in spezifisch geregelten Kontexten und dabei für wenige. Alle hierarchischen Gesellschaften benutzten frontale Verfahren zur Sicherung von Unterwerfung und Verkündung von Normen, Werten, Verhaltensanweisungen.
Im Abendland ist die frontale Methode insbesondere mit der Verkündigung von Glaubensregeln verbunden. Mit der Aufklärung beginnt eine andere Form der Didaktik, indem die frontale Methode von zwei Seiten eine Relativierung erfährt: Zum einen sollen die Wahrheiten, die von vorne gelehrt werden, nun nachweislich natürlichen Gesetzmäßigkeiten entsprechen und dabei anschaulich dargestellt werden (so besonders seit Comenius), zum anderen soll bei bestimmten Themen ein genaues beobachten der Lerner zum Zwecke des Nachvollzugs ermöglicht werden. Von diesen beiden Relativierungen her wurde die Frontalmethode nach und nach aufgeweicht.
Mit der Reformpädagogik beginnt ein deutlich andere Lernverständnis und damit auch eine kritische Einschätzung des Frontalunterrichts. John Dewey hat die Ansprüche an eine Didaktik der Moderne in folgendes Bild gefasst (vgl. dazu Reich, K.: Systemisch-konstruktivistische Pädagogik, Kapitel 11):
Die traditionelle Didaktik war die eines Klosters, eines gebundenen Systems, das elitär ausgerichtet war und sich mehr an der Vergangenheit und geschlossenen Weltbildern als an Alltag und Zukunft orientierte. Sie war Ausdruck einer Schule, in der die Inhalte von den Methoden getrennt wurden, in der eine künstliche Isolation von der Lebenswelt stattfand, eine Buch- und eine Wissensschule dominierte, deren reproduktive Lernformen auf symbolische Geschlossenheit hinausliefen. Es handelte sich bei einer Didaktik in solchen Schulen um ein formalisiertes Modell möglichst weitreichender Kontrolle, die als Reproduktion sicheren Wissens und scheinbar ewiger Wahrheiten verstanden wurde. Eine solche Didaktik musste in einer Moderne nach heftigen politischen Kämpfen scheitern, die auf Industrialisierung, Expandierung von Märkten, auf Fortschritt im Sinne von Wissensdifferenzierung, auf Demokratisierung im Sinne von stärker werdender Beteiligung auch der Volksmassen ausgerichtet war. Aber dieses Scheitern nun führte auch weg von der Geschlossenheit, der einen richtigen Lösung, die das Kloster noch bieten konnte. Die Aufklärung mochte sich bemühen, wie sie wollte, ihr ging die Einheit verloren. Der Kapitalismus beschleunigte daher die Entstehung von Didaktiken, die wir als Wühltisch- oder Supermarktdidaktiken bezeichnen können.
Wodurch zeichnen sie sich aus? Niemand weiß, welche zwischen all den vorhandenen Didaktiken nun die richtige sei. Es bleibt den Vorlieben überlassen, bestimmte Modelle zu wählen und sich gegen andere zu entscheiden. Es gibt nicht hinreichende überparteiliche Kriterien für diese Entscheidungen, es sei denn wir rechneten Gewohnheiten, Statusbedürfnisse bestimmter Kontrollgremien, Karriereerfordernisse von Wissenschaftlern im gegenseitigen Streit hierzu. Bei diesen Modellen nun sieht man geschlossene und offene Systeme. Die geschlossenen Modelle vertrauen im Grunde auf eine modifizierte Klostermentalität, also sie schauen in gewisser Weise zurück, wenn sie bestimmte Sichtweisen als die einzig richtigen propagieren: Sei es z.B. die Anthroposophie Rudolf Steiners oder eine ihrer Abwandlungen, die Weltsicht Maria Montessoris oder irgendein anderes geschlossenes Weltbild, also Ansätze, die in eine mitunter durchaus liebenswerte Gefangenschaft führen, deren Konstruktionen allerdings über kurz oder lang immer auch in eine gewollte Abhängigkeit führen. Dagegen werden offenere Modelle heute gerne bevorzugt, aber sie tragen den Nachteil, dass sie sehr schnell in die Beliebigkeit methodischer Setzungen im Sinne eines anything goes führen können.
Entscheidend für den viablen Einsatz eines offenen Konzeptes ist die Haltung der Lehrerin und des Lehrers. Eine solche Haltung erst sichert einen Einsatz, der den Wühltisch vermeidet, ohne in das Kloster zurückfallen zu müssen. Was aber macht eine solche Haltung aus?
Am besten scheint uns dies gegenwärtig David Finkel in seiner Einführung in ein Unterrichten with your mouth shut zu beschreiben. Dabei gibt er u.a. folgende Anregungen zu folgenden Fallgruppen (von uns mit eigenen Kommentaren versehen):
-
Teaching with your mouth shut : Lehrer sind oft Vielredner, zu ihrer Profession scheint der offene Mund notwendig dazu zu gehören und dies mag den Besserwisser fördern, der sich in alles schnell und sicher einmischen will. Dagegen hat die empirische Forschung der letzten 25 Jahre mehr und mehr nachgewiesen, dass das Lernen komplexer verlaufen muss: wer sich nach dem Unterricht noch länger an das Vermittelte erinnern soll und will, der muss es aktiv angeeignet haben, auf neue Situationen übertragen können, Fertigkeiten im Denken und in der Problemanwendung gegenüber den Gegenständen entwickeln, Lösungsstrategien kennen und Fortschritte sowie emotionale Reaktionen gegenüber Wegen und Ergebnissen zeigen, er muss seine eigene Motivation steuern lernen und seine Erwartungen und Verhaltensweisen ändern können. Für all dies aber ist eine frontale Methode denkbar schlecht geeignet. Dazu müssen wir nur an das Zurückdenken, was unser Lernen am meisten beeinflusst hat (vgl. Finkel 2000, 6 ff.): Was waren z.B. die drei wichtigsten Lernerfahrungen, die Sie je gemacht haben? Schreiben Sie dies auf und analysieren Sie bitte, welche Lernmethode dabei vorherrschend war. Kontrollieren Sie, ob die folgenden Bedingungen zugetroffen haben:
1. Geschah es im Klassenzimmer?
2. Geschah es in der Schule?
3. Was ein Lehrer/eine Lehrerin instruierend und instrumentell tätig,
damit die Lernerfahrung gemacht werden konnte?
4. Oder gab es jemanden, der vergleichbar wie ein Lehrer/eine Lehrerin tätig war (z.B. ein Coach, Berater usw.)?
5. Wenn die Antwort 3 oder 4 gewählt wurde, was tat der Lehrer/die Lehrerin, um Ihnen zu helfen?
6. Ganz allgemein, welche Faktoren führten instrumentell dazu, dass das Lernen stattgefunden hat?
Die Antworten, die hier in der Regel gegeben werden, verweisen darauf, dass wir besonders effektiv gelernt haben, wenn wir eben nicht unterrichtet wurden. Es waren Situationen, wo wir selbst handeln und agieren, beobachten und teilnehmen konnte, ohne dass eine Lehrerin oder ein Lehrer uns störten oder dominierten, wo sie mit geschlossenem Mund unterrichtet haben (sofern unsere besten Lernerfahrungen nicht überhaupt außerhalb des Unterrichts stattgefunden haben).
Die Konsequenz aus diesen Überlegungen lautet, dass wir unseren eigenen Lernerfahrungen intuitiv mehr vertrauen sollten als dem, was manche Lehrbücher sagen. Wir sollten unsere Lerner öfter fragen, was sie wie gelernt haben, und wir sollten in längeren Zeitabständen einmal überprüfen, was bei welcher Methode wirklich hängen geblieben ist. Dann werden wir unsere frontalen Vorgehensweisen von selbst relativieren, das sie viel weniger erfolgreich sind, als wir bisher meinten.
-
Lass die Bücher das Erzählen übernehmen : Erzählungen, Parabeln, Metaphern, Rätsel und Paradoxien, sie alle können gute Lehrer sein, weil sie konkret und anregend sind, weil sie übertragbar auf andere Situationen sind und unseren Geist anregen. Lehrende müssen oft nur einige Fragen stellen, um Antworten hervorzubringen, die die Lerner wie von selbst produzieren. Aber dies setzt Lehrende voraus, die selbst das Stauen nicht verlernt haben, die wissen, wo man Erzählungen, Texte, Bücher, Bilder usw. findet, die für eine Lerngruppe genug Anregung besitzen, um als relevant für bestimmte Problemstellungen gelten zu können. Jedes Fach hat seine eigenen Texte, die hier relevant sein können, aber gerade dort, wo frontal ausgebildet wurde, haben wir diese vielleicht bisher nicht kennen gelernt. Wir müssen uns auf die Suche machen.
-
Lass die Lerner das Sprechen tun : Warum sollen die Lehrenden so viel Zeit sprechen? Dies können oft die Lerner tun, um dabei mehr und aktiver zu lernen. Alle Lerner können zu Lehrenden werden. In der konstruktivistischen Didaktik heißt es, dass Lehrende und Lernende Didaktiker sind, aber dies bedeutet, dass die Lerner auch als Didaktiker gefordert und eingesetzt werden. Hier ist insgesamt für alle Fächer eine forschende Einstellung maßgeblich. Wenn wir sprechen, dann ist es meist zu einfach, nur eine vorhandene Information wiederzugeben. Wir empfinden einen größeren Reiz und eine bessere Herausforderung, wenn wir ein Problem haben, für das wir eine eigene Lösung finden. Das Unvorhersehbare, das Unvollständige und Überraschende reizt uns und unsere Teilnehmer mehr, wenn wir als Lerner miteinander sprechen und die Rollen von Lehrenden und Lernenden stets vertauschen. Dies kann einzelne Lerner aber auch Lernergruppen betreffen (im Methodenpool finden sich hierzu zahlreiche geeignete Methoden!). Die Lehrerin und der Lehrer müssen diesen Tausch nicht nur fordern, sonder aktiv organisieren.
-
Lass uns gemeinsam etwas untersuchen : Warum soll ich das lernen? Diese Frage steht immer am Anfang eines Lernprozesses. Wenn ein Lerner das Problem nicht sieht, dann gibt es keine emotionale Reaktion, kein Interesse, und allein Zwang oder Gewohnheit kann versuchen, die Instruktion zu retten. Die Kunst der Lehrenden besteht darin, nicht von außen zu motivieren, sondern überhaupt ein Problem und einen Lernsinn erkennbar werden zu lassen, damit gelernt wird. Leider ist es in einigen Fächern schwer geworden, das Problem noch zu finden, da zunächst Regeln, Techniken, Informationen zu sammeln und zu bewerten, auswendig zu lernen oder in engen Auslegungen anzuwenden sind, bevor es überhaupt zu den Problemen kommt. So müssen mathematische Grundfertigkeiten erworben, Vokabeln gelernt, Daten gesammelt werden usw. Hier könnte eine Untersuchungsmethode helfen, die im Prozess des Untersuchens die zu erwerbenden Regeln und Techniken usw. einbindet und damit verständlicher werden lässt. Der Vorbereitungsaufwand für Lehrende steigt hier erheblich, aber der Nutzen ist, dass mehr Lerner das Lernen einsehen und besser lernen werden. Auch die Lehrerausbildung muss stärker auf forschendes Lernen ausgelegt werden, damit die Vorteile dieser Methode verinnerlicht werden können. Dann gehen Lehrende fragend an jeden Stoff heran: Was können wir durch eine gemeinsame Untersuchung herausbringen? Von dieser Leitfrage her lässt sich der ganze Unterricht immer wieder neu denken und auch methodisch gestalten.
-
Sprechen mit geschlossenem Mund oder die Kunst des Schreibens : Was man schreibt, das bleibt. Was man selbst geschrieben hat, dazu hat man eine andere Beziehung als zu einem anderen Text. Was man sich mit Mühe erarbeitet hat, geschrieben hat, um es anderen zu zeigen, das erzeugt eine noch höhere Wirkung, weil es Anerkennung erfährt, wenn wir es miteinander besprechen. In Portfolios wird dies heute methodisch immer deutlicher erkennbar. Aber das Schreiben allein reicht nie aus, es muss immer auch kommuniziert werden, um den Lernern weitere Handlungschancen zu eröffnen und das Schreiben mit sozialem Sinn zu verbinden. Erst dann schreiben wir wieder gerne. Dies gilt insbesondere dann, wenn wir etwas zusammen schreiben.
-
Experimente, die unterrichten : Experimente stellen Erfahrungen bereit, die in allen Fächern möglich sind. Aus der Problemsituation heraus kann dann gelernt werden, weil und insofern die Lerner ein Problem verstehen und dann lösen. In der deutschen Didaktik hat dies insbesondere Wagenschein betont und hierfür zahlreiche Beispiele gegeben
(vgl. einführend http://martin-wagenschein.de;
zum Streit um Wagenschein vgl. z.B. http://www.uni-dortmund.de/MNU/2004/404Zuschrift.pdf).
Finkel macht darauf aufmerksam, dass Experimente im weiten Sinne von experience nach Dewey aufgefasst werden sollten. Dies fordert komplexe soziale Situationen heraus, in der Dinge nicht nur erforscht, sondern auch breit und effektiv kommuniziert werden. Dafür sind Workshops geeignet, die den herkömmlichen Zeittakt der Schule auflösen und komplexe Fragestellungen bearbeiten. Der Lehrende tritt hierbei zwar in der Aktion zurück, aber er muss in der Auswahl der Gegenstände und der Frage- sowie Problemstellungen immer auch eine Vorarbeit leisten, um das experience nicht zu flach oder ungeeignet werden zu lassen. Hier gibt es viele Methoden wie z.B. Leittexte und Projekte, die dies besonders leisten können. Gerade sie setzen zeitlich einen Workshopcharakter voraus.
- Die Trennung von Macht und Autorität im Klassenzimmer : Wenn Lehrende den Lernern immer sagen (direkt oder indirekt), was sie zu tun haben, dann erzeugen sie (ob sie es wollen oder nicht) eine autoritäre Abhängigkeit (bis hin zu einem blinden Gehorsam). Oft wird dies durch eine Freundlichkeit verborgen, die die autoritäre Abhängigkeit verbirgt und verschleiert. Spätestens bei der Vergabe von Noten oder Strafen tritt sie dann doch hervor. Doch was geschieht, wenn ein Lehrender sich solcher Lehre verweigert? Was geschieht, wenn die Lehrende nicht mehr unterrichten will? Aus der Sicht der Frage nach der Macht, wie sie seit Foucault gestellt wird, muss man schlussfolgern, dass dies gar nicht geht. Der Kontext von Lehrenden und Lernenden in ganz gleich welchen Gruppen zeigt fast immer ein Machtgefälle zwischen dem, der etwas organisiert und den anderen, die in einem strukturell vorgegebenen Setting lernen sollen. Dabei kommt es weniger darauf an, wie sich der Lehrende in seiner Rolle fühlt, sondern vielmehr darauf, was der Kontext an Machtpositionen bereithält. Hier ist es erstaunlich, dass gerade Lehrende, die sich didaktisch konstruktiv verhalten, die also den Mund sehr oft geschlossen halten, immer dann, wenn sie ihn öffnen, besonders wichtige Dinge für die Gruppe preiszugeben scheinen. Es wäre eine Illusion, dies vertuschen zu wollen. So, wie der Lehrende sich in diesen Machtfragen verhält, erzeugt er ein Verhältnis zur Demokratie (vgl. Demokratie im Kleinen ) und ein politisches Klassenzimmer. Die Lerner in einer Lerngruppe lernen immer am Verhalten gegenüber Machtfragen implizit etwas über demokratische Chancen. Konstruktivistisch orientierte Lehrende bevorzugen dabei die Offenlegung von Machtstrukturen (= Dialoge über Positionen, Grenzen und Abhängigkeiten). Finkel schlägt vor, dass wir in Lehr- und Lernprozessen durchaus immer wieder (kontinuierlich und nicht bloß selten!) Macht an die Lernenden abgeben sollten, ohne dabei die Autorität in der Klasse verlieren zu müssen. Mit Autorität ist hier im positiven Sinne gemeint, dass es eine durchgehende Verantwortung der Lehrenden für die Lernenden gibt. Diese Autorität gründet meistens in der institutionellen Macht, die Lehrende von ihrer Position her meist ohnehin nicht abgeben können. Aber sie können und müssen Teile der Macht dort bewusst abgeben, wo sie partizipativ die Lernenden eigene Sichtweisen entwickeln lassen wollen. Dies darf nicht in abgelegenen Themengebieten oder bei unwichtigen Fragen geschehen, sondern muss sich gerade auf die Fundamente des Lernens beziehen: ohne Partizipation der Lerner fallen wir in autoritäre Unterwürfigkeit zurück!
- Unterrichten mit KollegInnen : Teamteaching ist ein Ideal konstruktivistischer Didaktik, um mehrperspektivische Zugänge und multimodale Herangehensweisen zu erleichtern. Lehrende sind oft überfordert, wenn sie die einfacheren, frontalen Methoden aufgeben wollen, weil sie nun etwas tun müssen, was sie selbst in ihrer Lernerbiografie meist zu wenig erfahren haben. Da man aber im institutionellen Rahmen meist keine KollegInnen in den Unterricht bekommt, ist es möglich und richtig, die Lernenden selbst zu KollegInnen werden zu lassen. Ein wesentliches Prinzip konstruktivistischer Didaktik ist es, dass Lerner zu Lehrern werden. Dies gilt zunächst für alle Präsentationen im Unterricht. Aber dies kann und sollte auch für Planungsprozesse, das Erstellen von Klausuren, für Feedback und Evaluation gelten. Lernende planen Unterricht für ihre oder eine andere Klasse. Sie erstellen als Teilgruppe eine Klausur für ihre Lerngruppe oder eine andere und werten die Ergebnisse aus. Sie beobachten als Teilgruppe (z.B. reflecting team ) den Unterricht und geben Feedback an alle usw.
3.2. Praktische Begründung
Der Frontalunterricht lässt sich praktisch aus einer didaktischen Perspektive ableiten, die der Tradition der Schule entspringt: Lehrende sind Experten, Lernende Laien. Aber diese praktische Ableitung zeigt auch direkt die Schwierigkeit, in die man lerntheoretisch gerät. So will man heute, dass die lernenden am Ende von Lernprozessen die Kompetenzen von Experten aufweisen, aber bis dahin muss ihnen genau diese Kompetenz anscheinend verwehrt werden. Der Umkehrschluss lautet deshalb: Frontalunterricht ist eine Methode, die sehr stark beschränkt und zeitlich begrenzt werden muss, sofern Lerner möglichst schnell und in gelebter Erfahrung zu Kompetenzen gelangen sollen.
Wenn aus der Praxis heraus auf Erfolge des Frontalunterrichts verwiesen wird, so ist immer der kulturelle Kontext mit zu bedenken. Erfolgreich ist er in der Tat in einem autoritativen System mit starken äußeren Lernanreizen (Belohnung oder Bestrafung), wobei durch äußeren Druck oder aus Angst gelernt wird. So kann gelernt werden, aber weder das Behalten von meist stupide auswendig gelernten Stoffen noch die dabei mit gelernten sozialen Verhaltensweisen sollten als günstig oder wünschenswert angesehen werden. Die negativen Seite autoritärer Unterwürfigkeit lassen sich vermeiden, wenn frontale Phasen beschränkt werden und mit dialogischen Methoden kombiniert und insgesamt in eine offene Beziehungs- und Kommunikationskultur gestellt werden.
Frontalunterricht ist deshalb eine Lehrmethode mit relativem Stellenwert. Insgesamt hat er in einem umfassenden methodischen Arrangement beschränkte sinnvolle didaktische Funktionen hat:
-
Frontalunterricht gilt als besonders ökonomisch. Er hilft Zeit und somit Geld zu sparen.
-
Er eignet sich sowohl für Unterrichtsinhalte und Zielüberlegungen, die einen geringen Schwierigkeitsgrad aufweisen und den auch schwächere Schüler verstehen können als auch für besonders abstrakte und schwierige Themen, bei denen allein der Lehrende den Überblick zu behalten vermag.
-
Bestimmte Inhalte und das Ziel der Kenntnisse von bestimmten Daten, Personen, Fakten, Ereignissen, Orte (z.B. als Einführung in ein Thema oder als Hinführung) scheinen sich besonders günstig frontal vermitteln zu lassen.
Bildungstheoretisch trösten sich Lehrende mit der Einwegstraße Frontalunterricht (= allein vom Lehrenden zum Lernenden) mit dem Hinweis, dass im Anschluss ja eine Eigenständigkeit des Lerners kommen kann. Allerdings bleibt gerade dies dann oft vergessen und wird nicht hinreichend didaktisch gesichert.
Die konstruktivistische Didaktik lehnt frontale Unterrichtsphasen nicht durchweg ab. Aber sie versucht, die frontalen Phasen von ihrer Lernerwirksamkeit her abzuschätzen. Lehrende müssen über frontale Phasen z.B. wissen:
-
Die Motivation der Schüler/innen ist eher als gering einzuschätzen und von den drei Grundbedürfnissen Autonomie, Selbstwirksamkeit und soziale Nähe sind zumindest die ersten zwei stark eingeschränkt.
-
Für ein gutes Gelingen ist es daher notwendig, das Interesse der Lerner an der Sache und der Didaktisierung zu wecken. Dies kann erreicht werden durch eine soziale Nähe des Lehrers/der Lehrerin zu seinen Lernern, durch das Gefühl des Zutrauens in den Lernerfolg der Klasse. Das heißt, der Lehrer/die Lehrerin kann hier folgendes leisten: er/sie kann Grundwissen allen Lernern vermitteln und Interesse wecken durch ein Referat oder Problematisieren des Themas.
-
Durch das frontale Setting hat er/sie alle im Blick, was ihm/ihr erleichtern kann, alle konzentriert auf ein Problem hin zu orientieren oder in ein Thema einzuführen (was allerdings eine überzeugende Präsentationsqualität voraussetzt).
-
Außerdem kann der Lehrer/die Lehrerin durch ihr frontales Setting ein Modell für erfolgreiches und angemessenes Handeln abgeben. Darüber hinaus zeigt er/sie methodische Kompetenzen des eigenen Lernens und Arbeitens auf. Durch gut strukturierten Unterricht zeigt er/sie den Schülern/innen, wie man ein Problem angehen und lösen kann. Das Erlernen dieser Kompetenzen weist weit über den Schulalltag hinaus, denn die Schule ist irgendwann zu Ende, das Anwenden von Arbeitsmethoden nie.
-
Zudem ist die frontale Methode bei Präsentationen von Lernern geeignet, sie selbst in die Position von Lehrenden zu versetzen und dabei Kompetenzen zu erwerben.
Frontale Methoden sollten aber immer kritisch begründet werden. Wenn ich sie einsetze, so muss ich mir der Grenzen des Einsatzes bewusst sein. Will ich allen Lernenden z.B. gemeinsam einen bestimmten, abgegrenzten, klar strukturierten Wissensbereich präzise vermitteln, Zusammenhänge von einzelnen Inhalten aufzeigen oder Zusatzinformationen zur Gruppenarbeit geben, dann könnte ich dies sinnvoll durch einen Lehrervortrag frontalunterrichtlich gestalten. Aber ich muss auch wissen, dass ich dadurch bereits bestimmte Zeichen setze und dem Lernen einen Hintersinn verleihe (= seht, jetzt sage ich euch, wo es langgeht).
Meist gehen frontale Phasen vom reinen Lehrervortrag oder einer Präsentation in eher gesprächsorientierte Phasen über, die aber dennoch frontal ausgelegt sind. Für das „vom Lehrer gesteuerte Unterrichtsgespräch“ gibt es zahlreiche verwandte Begriffe wie fragend-entwickelndes Verfahren, erarbeitender Unterricht, Frage-Unterricht, Lehrgespräch, entwickelnder Frageunterricht u.v.m., denen z.B. folgende Strukturmerkmale gemeinsam sind:
- die Lehrkraft lenkt die Interaktion direkt,
- Lehrerfragen und Schülerantworten können sich abwechseln,
- die Lehreraktivitäten zeigen ein breites Spektrum, das von offenen Impulsen über eine Fülle unterschiedlicher Fragearten bis zu sehr engen suggestiven Fragen mit Ein-Wort oder Ein-Satz-Antwortmöglichkeiten reicht,
- Interaktionen zwischen den Schülern werden immer dann zugelassen, wenn sie dem Unterrichtsziel der Lehrkraft dienen,
- insgesamt geht es darum, die Denkschritte der Lehrkraft nachzuvollziehen.
Wann aber sind frontale Phasen sinnvoll? Dies ist eine kritische Frage an jeden Lehrenden und jede Lerngruppe. Selbst diejenigen, die frontale Phasen total ablehnen, werden wir gelegentlich doch dabei ertappen können, dass auch sie etwas frontal abhandeln. Uns geht es darum, dass dies reflektiert und nicht bloß zufällig geschieht. Also wollen wir fordern:
-
Frontale Phasen können immer bei Informationsvermittlungen begrenzt eingesetzt werden, wenn man mit der Lerngruppe erörtert, warum man jetzt so vorgeht.
-
Einführungen, Zusammenfassungen, Vertiefungen und Weiterführungen von Inhalten werden oft in frontalen Phasen realisiert. Dies sollte aber nicht nur der Lehrende vornehmen, sondern auch Lerner zum Zuge kommen lassen.
-
Frontale Phasen kann es z.B. geben, wenn die Lehrkraft während der lerneraktiven Phasen der Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit oder bei handlungsorientierten Methoden einen Abschnitt einbauen muss, in dem der ganzen Lerngruppe fehlende Sachkenntnisse vermittelt werden sollen. Oder wenn Lösungswege rechtzeitig problematisiert werden sollen. Auch wenn es sich um eine Aufgabe handelt, bei der die Lerner auf sich allein gestellt überfordert wären.
-
Gesprächskultur entwickeln: Darüber hinaus können die Lerner in frontalen Phasen eine lebendige Interaktion mit der Lehrperson erfahren. Ihre Mimik, Gestik, Bewegung im Raum und die sprachlichen Gestaltungsmöglichkeiten können den Kontakt lebendig machen und sogar das emotionale Engagement kann für eine bestimmte (meist kurze) Dauer hoch motivierend sein. In diesem Zusammenhang ist allerdings die „Vorbild-Funktion“ des Lehrers/der Lehrerin wichtig. Hier ist es entscheidend, dass frontale Phasen stets die Möglichkeit von Zwischenfragen oder kurzen Dialogen einschließen müssen. Langfristig gesehen kann auch im Frontalunterricht eine Gesprächskultur aufgebaut werden: zuhören, ausreden lassen, aufeinander Bezug nehmen, sachlich bleiben, argumentieren lernen. Durch die Anleitung des Gespräches kann die Lehrperson diese Regeln etablieren und immer wieder auf die Qualität des Gespräches achten. Allerdings gibt es um so weniger Gespräch je länger die frontale Phase dauert!
-
Auch in frontalen Phasen wird die Kontaktfähigkeit, Beziehungsfähigkeit, ein gerechtes Verhalten und ein angemessener Umgang mit Störungen und Konflikten zwischen Lehrenden und Lernenden wesentlich. Nur vor dem Hintergrund einer Beziehungsdidaktik, d.h. eines offenen kommunikativen Verhaltens der Lehrkraft und einer wertschätzenden Haltung mit dem Anspruch, alle Lerner zu fördern, werden frontale Phasen als bereichernd für das Lernklima und Lernen insgesamt gesehen werden können.
-
In frontalen Phasen können Lerner erfahren, dass über Sprache wichtige Informationen, aber auch zwischenmenschliche Belange vermittelt und geklärt werden können. Durch die aktive Teilnahme am Unterrichtsgespräch können sie sich sprachlich darin üben, ihr Wissen, ihre Fragen und zwischenmenschlichen Konflikte auf verbaler Weise auszudrücken. Hierbei hat die Lehrperson im sprachlichen Bereich einen großen Einfluss durch die Gestaltung des Unterrichts. Die Lerner können und sollen in einem wertschätzenden und ermutigenden Klima ihre sprachlichen Kompetenzen an denen des Lehrers/der Lehrerin messen und sich an einem gemeinsamen Dialog orientieren. Dabei entstehen wichtige Kompetenzen für das soziale Miteinander in Schule, Beruf und Privatleben. Dies bedeutet jedoch ganz klar, dass frontale Phasen immer mit Gesprächsphasen verbunden sein müssen! Dafür ist hinreichend Zeit einzuplanen.
-
Frontale Phasen ermöglichen oft direkte Rückkopplungen mit einzelnen Lernern. Sie sollten auf die Nutzung der Potenziale der ganzen Klasse zielen, was aber mit dieser Methode nur sehr schwer zu erreichen ist. Hierbei lassen sich teilweise auch dramaturgische Effekte einsetzen. Allerdings ist darauf zu achten, dass dies nie zu einer bloßen Show verkommt. Insbesondere muss die Austauschbarkeit der Lehrkraft vorne erhalten bleiben (= Lerner als Didaktiker einsetzen).
-
Frontale Phasen sollten keine Monokulturen bevorzugen, sondern den Pluralismus in einer Lerngruppe fördern. Dewey fordert für die Demokratie im Kleinen eine Gruppe, die als Gemeinsamkeit eine zunehmende Unterschiedlichkeit in der Gruppe ermöglicht. Dies sollte insbesondere bei frontalen Lehrformen beachtet bleiben. Eine erlebte Pluralität mit Konsens und Dissens, wobei als Wir-Gefühl die Ermöglichung einer gegeneinander kritischen Auseinandersetzung über Themen und Probleme entsteht, dies stellt ein orientierendes Ideal dar, das auch in der frontalen Phase und gerade in ihr gilt. Nicht nur die Lehrperson, sondern alle Lerner, die vorne Prozesse gestalten, geben einen „Orientierungsrahmen“ ab, um das frontale Setting immer wieder zu öffnen und aus einer autoritären Unterwürfigkeit zu befreien.
-
Frontale Phasen neigen dazu, dass das soziale Klima einseitig auf die agierende Person nach vorne verschoben wird, dass es zu einer Vernachlässigung der individuellen Lernerbedürfnisse kommt, dass autoritative Bindungen verstärkt werden, dass einfache Formen rezeptiven Lernens verstärkt werden, dass zu viel Stoff in zu kurzer Zeit eingepaukt wird, dass die Methoden- und Sozialkompetenz der Lerner vernachlässigt wird. Diesen Punkten kann nur dann hinreichend entgegen gewirkt werden, wenn die frontale Phase zeitlich begrenzt wird. Es muss immer wieder evaluiert werden, welche Aufmerksamkeit die Lerner aufbringen können. Zudem müssen andere Methoden umfassend nach der frontalen Phase eingesetzt werden, die stärker handlungsorientierend wirken. Hier reicht es nicht aus, bloß kurze Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit einzusetzen, sondern hier ist eine Methodenkompetenz zu entwickeln, die vor allem auf die großen handlungsorientierenden Methoden des Methodenpools zurückgreift. Wichtig ist dabei, dass die Balance zwischen den einzelnen Methoden innerhalb der didaktischen Intentionen und institutionellen Rahmenbedingungen gehalten wird. Wenn die Balance kippt, landen wir bei einem überwiegend lehrergesteuerten Unterricht (wie es heute noch in vielen deutschen Schulen die Regel ist), bei einer lehrerzentrierten Kommandostruktur und beim „Beibringen“ im Sinne des Nürnberger Trichters. Bekommt die Einzelarbeit dann als Ausgleich zur Frontalkultur zu viel Gewicht, haben wir eine Individualinstruktion und fallen letztlich in das traditionelle Modell des Hauslehrers zurück. Dies ist angesichts heutiger Lebenserfordernisse rückschrittlich. Wird die Partner- oder Gruppenarbeit nicht umfassend in eine sinnvolle und auf die Lerngruppe abgestimmte Gesamtstruktur der handlungsorientierten Methoden eingebunden, dann zerfällt der Unterricht leicht in für die Lerner nicht hinreichend überschaubare, in unkoordiniert erscheinende und wenig aufeinander bezogene Teile, die nicht angemessen zusammengedacht werden können. Deshalb müssen sich Lehrende immer ein Gesamtkonzept aus frontalen und lernerorientierten Phasen überlegen und die Wirkung ihres Konzeptes in ihren Lernergruppen auch in seiner Wirksamkeit evaluieren!
-
Frontale Phasen sollten nie aus bloßer Bequemlichkeit der Lehrenden (weniger Vorbereitung und bloße Routine sowie disziplinarisch günstiger) noch der Lernenden (passives Ausruhen) eingesetzt werden.
-
Frontale Phasen sind bei Präsentationen von Lernern oft unvermeidlich. Es ist für sie eine relativ einfache Form, ihre Ergebnisse anderen zu präsentieren. Dabei können sie eigene Kenntnisse zu einem erarbeitenden Thema beitragen, gemeinsame Erfahrungen klären, Lösungswege ausprobieren, argumentierende Auseinandersetzungen führen oder kritisch-analysierende Stellungnahmen lernen. Dies dann in eine didaktisch aufbereitete Präsentation oder die Präsentation eines Portfolios zu bringen, ist eine wesentliche Qualifikation, die heute außerhalb des Kontextes Schule grundsätzlich verlangt wird. In der beruflichen Praxis, in der lebenslanges Lernen gefordert ist, wird es dazu kommen, dass man an betrieblichen Weiterbildungen teilnehmen muss oder in diversen anderen Zusammenhängen Meetings erlebt mit vielen Vorträgen. Da ist es wichtig, einen Vortrag für sich effektiv sowohl als Ersteller wie als Nutzer handhaben zu können. Im Erstellen wie im Zuhören geschult zu sein und zu wissen, worauf es dabei ankommt, dies sind wichtige Kompetenzen, die hier gefordert sind: z.B. die Informationen rauszufiltern, die für den eigenen Arbeitsprozess wichtig sind; den Kern des Vortrages zu erkennen; eine didaktische Gestaltung zu planen und durchzuführen; gezieltes Feedback zu Vorträgen geben zu können.
Für die Schule kann der Frontalunterricht nur begrenzt effektiv sein. Diese Effektivität ist an einen zeitlichen, inhaltlichen und arbeitsökonomischen Rahmen gebunden, denn handlungsorientierte und lernereffektive Methoden brauchen einfach mehr Zeit als die herkömmliche Schule oft gewähren will. In Deutschland gibt es hier zudem das Problem völlig überfüllter und damit auch unrealistischer Lehrpläne, die den Unterricht zu sehr in die Frontalmethode treiben. Wenn der Stoff nicht mehr handlungsorientiert zu schaffen ist, dann verfallen Lehrende oft im Druck des Systems in frontale Muster und alle Beteiligten wundern sich am Ende, warum die deutsche Schule in internationalen Schulleistungstests schlecht abschneidet. Insbesondere die fachwissenschaftliche Dominanz im Lehrerstudium tut hier ein Übriges, die Situation nicht grundlegend zu verbessern, da alle Fächer sich selbst als außerordentlich wichtig in ihren immer umfassender werdenden Grundlagen sehen. Erfolgreiche Länder in internationalen Schulleistungstests unterrichten weniger Stoff, aber diesen lernergerechter. Sie folgen, wie etwa die Finnen, schon länger den hier vertretenen Einsichten einer konstruktivistischen Didaktik.
|