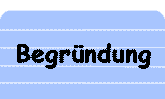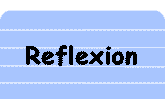3.
Theoretische und praktische Begründung
>> 3.1 Theoretische Hintergründe
>> 3.2 Ursprünge des Werkstattunterricht-Konzepts: Bezüge zur Reformpädagogik
>> 3.3 Aktuelle Begründungszusammenhänge
>> 3.3.1 Kindheit im Wandel
>> 3.3.2 Eine Kulturrevolution
>> 3.3.3 Zusammenfassung
Begriffe mit * finden sich im Glossar am Ende von Teil 4 Darstellung
3.1 Theoretische Hintergründe
Das Konzept des Werkstattunterrichts nach Reichen baut auf verschiedenen Theorien und Hintergründen auf. Um zu verstehen, zu welchem Zweck das Konzept entwickelt wurde und welche Ziele es verfolgt, ist es wichtig, diese zu kennen. Daher werden im Folgenden zunächst die lerntheoretischen Grundlagen des Konzepts vorgestellt. Anschließend wird das übergeordnete Unterrichtsmodell Reichens erläutert, in das Werkstattunterricht, als einer von verschiedenen Teilen, eingebettet ist.
3.1.1 Die Lerntheorie Reichens
Zum Lernen:
Reichen (1991, S. 15) weist auf die Bedeutung von richtigem und falschem Lernen hin: „Je mehr ein Mensch bereits richtig gelernt hat, umso mehr, leichter, schneller und besser lernt er dazu. Je mehr ein Mensch bereits falsch gelernt hat, desto schlechter lernt er dazu. [...] „Richtig“ ist deshalb alles Lernen, welches weiterführendes Lernen ermöglicht und offen hält, „falsch“ ist alles, was weiteres Lernen blockiert“.
Daraus ergibt sich die Konsequenz für die Schule, dass es vor allem darauf ankommt, alles Lernen auf Transfer hin anzulegen.
Reichen (1991, S. 16) führt aus, dass es zu jeder Lernzielkategorie unterschiedlich geeignete Verfahren gibt: So werden sensomotorische Fertigkeiten am besten durch Nachahmung und Übung angeeignet, kognitive Fähigkeiten durch programmierte Übung mit Sofortkontrolle. Alles andere in der Schule geforderte Lernen sollte jedoch möglichst ein Lernen durch Einsicht und Selbstentdecken sein, da es sich nur so offen halten und auf Transfer hin anlegen lässt.
Um ein solches Lernen in der Schule zu ermöglichen, muss der Unterricht prozessorientiert statt produktorientiert ausgerichtet sein. Es kommt also mehr auf den richtigen Weg zum Ergebnis an, als auf ein vorzeigbares Ergebnis.
Dies folgt auch der Erkenntnis, dass sich Lernen nicht als linearer Prozess in regelmäßigen kleinen Schritten vollzieht, sondern oft in überraschenden Sprüngen, in nicht geplanten und nicht bewussten Prozessen und oft zu Zeiten, in denen man es am wenigsten erwartet, vollzieht (vgl. Busch 1992, S. 15).
Die herkömmliche Schulpraxis besteht dagegen überwiegend aus einem undifferenzierten Nachahmungslernen durch Üben, wobei der Lehrer die aktive Rolle im Unterricht einnimmt, die Schüler jedoch fast nichts erarbeiten (vgl. Reichen 1991, S. 17).
Um diese Art von Lernen zu überwinden, muss laut Reichen (1991, S. 17) der gesamte Unterricht kognitiv ausgerichtet werden; d.h., der Schüler soll nicht nur mechanisch reproduzieren, sondern stattdessen wissen, was er lernen soll, wie er das bewerkstelligen soll und aus welchem Grund er lernen soll.
Dies führt zu der Forderung nach selbstgesteuertem Lernen*: Der Schüler übernimmt dabei zugleich die Rolle des sich selbst Lehrenden; er plant den Lernvorgang, beschafft notwendige Informationen, wählt geeignete Methoden aus, überprüft schließlich auch den eigenen Lernfortschritt und übernimmt auf diese Weise Selbstverantwortung für sein Lernen (vgl. Reichen 1991, S. 18).
Selbstgesteuertes Lernen hat die Lernprozesse des Alltags, insbesondere die des Kleinkinderlernens zum Vorbild. Hierbei zeigt sich, dass der Mensch offensichtlich dann am effektivsten lernt, wenn das Lernen selbstgesteuert ist. Selbststeuerung bildet den Kern jedes Lernprozesses. Reichen (1988a, S. 36 f.) folgert daraus: „Ein ausreichendes Ausmaß an Selbststeuerung durch den Lernenden ist eine kritische Bedingung für erfolgreiches Lernen.[...] Je mehr Möglichkeiten der Schüler zur selbständigen, aktiven Arbeit hat, um so grösser wird sein Lernerfolg“.
[Anmerkung: Bei wörtlichen Zitaten wird die originale Schreibweise beibehalten. Die Rechtschreibung in Zitaten kann deshalb von der neuen deutschen Rechtschreibung abweichen: Zitate nach Jürgen Reichen sind zudem meist in der Rechtschreibung der Schweiz verfasst und enthalten daher keine ß-Schreibung.]
Vermutlich ist ein Grund für den Erfolg des selbstgesteuerten Lernens, dass es auf sogenannten Präfigurationsprozessen* aufbaut.
Die Präfigurationstheorie geht von der Annahme aus, dass es während eines Lernprozesses zwischen dem Anfangspunkt, an dem der Lernende noch nichts von dem Lerngegenstand weiß, und dem Endpunkt, an dem der Lernprozess erfolgreich abgeschlossen ist, eine so genannte Präfigurationsphase gibt, in der der Lernende die zu lernende Sache „halb“ oder „teilweise“ kann. Diese Zwischenzone entzieht sich weitgehend einem methodisch-didaktischen Direktzugriff.
Daraus ergibt sich die Konsequenz, dass ein Kind nicht unbedingt eine bestimmte Leistung erst vollständig beherrschen muss, bevor mit der Erarbeitung der nächst höheren Stufe begonnen werden kann. Man kann auch überlappend vorgehen und die Kinder durch ein begabungsüberschießendes Lernangebot gezielt und systematisch überfordern. Eine bestimmte Menge an Lernlücken bzw. noch offenen Lernprozessen unterstützt den Gesamtlernprozess in positiver Weise.
Wichtig ist jedoch, dass man dabei auf jeglichen Leistungsdruck verzichtet und die gewollte Überforderung richtig dosiert: die Menge der Lernlücken sollte nicht zu groß werden (vgl. Reichen 1988a, S. 40).
Zur Motivation*:
Reichen (1991, S. 20) umschreibt Motivation als „psychischen Antrieb, als Motor, der das Lernen in Gang setzt und in Gang hält“. Er weist darauf hin, dass Motivation seit den 60er Jahren im Zentrum aller lernpsychologischen, didaktischen und methodischen Überlegungen steht. „Sie nimmt im Rahmen aller Lernprozesse einen zentralen Platz ein und zeigt sich in der Schule als Lernbereitschaft und Leistungswille“ (Reichen 1991, S. 20). Je nach Motivationsfaktoren unterscheidet man die primäre oder intrinsische Motivation, die vom Sachinteresse her motiviert und die sekundäre bzw. extrinsische Motivation durch sachfremde Faktoren. In der Regel beruht Motivation in der Praxis jedoch auf einem Wechselspiel von Sachinteresse und sachfremden Faktoren.
Eine wichtige Rolle beim Aufbau von Lernmotivation spielen laut Reichen (1991, S.20 f.) sowohl das Lust- als auch das Leistungsprinzip: Einerseits leistet und erreicht man mehr, wenn das Arbeiten lustbetont ist, andererseits wirkt ausschließlich lustbetontes Arbeiten verwöhnend.
Reichen zieht nun folgende Konsequenzen: Das Lernangebot sollte auf der einen Seite so interessant gestaltet sein, dass es Neugierde weckt. Da Neugierde jedoch nur Neuem gegenüber möglich ist, muss der Unterricht so angelegt werden, dass Begreifen auf Anhieb und ohne Zwang zur Wiederholung möglich ist. Andererseits sollte der Schwierigkeitsgrad des Angebots so dosiert werden, dass der Schüler in seiner Selbsteinschätzung die Aufgaben als lösbar ansieht und sie ihn weder unter- noch überfordern (vgl. Reichen 1991, S.21). So wirkt nach Guyer (1956, S.139 ff., zitiert nach Reichen 1988a, S. 38) der deutlich erlebte, aber nicht unüberwindbare Lernwiderstand stark motivierend.
Reichen (1991, S. 23) bezieht sich auf Heckhausen, wenn er bestätigt, dass der mittlere Schwierigkeitsgrad die Hauptbedingung für Motivation optimal erfüllt: „Im innersten Kern stammt hohe Lernmotivation nämlich aus der Vorwegnahme (Antizipation) des Erfolgserlebnisses“.
Da Ergebnisse des Lernbemühens demnach entscheidend abhängig von ihrer psychischen Vorwegnahme sind, ist es von größter Bedeutung, dass der Schüler erfolgszuversichtlich ist. Dies ist er, wenn er ein gutes Selbstbewusstsein dank bisheriger Erfolgserlebnisse hat: „Nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg. Je mehr die Lernanstrengungen eines Schülers zu Erfolgen führen, desto eher ist er auch bereit, sich neuen Lernanforderungen zu stellen“ (Reichen 1991, S.23).
Daraus ergibt sich die Konsequenz, dem Schüler zu möglichst vielen Erfolgserlebnissen zu verhelfen.
Auch in diesem Zusammenhang, vom Spannungsfeld Erfolg/ Misserfolg aus gesehen, ist wiederum der Schwierigkeits- bzw. Erreichbarkeitsgrad von Aufgaben für die Lernbereitschaft ausschlaggebend. (vgl. Reichen 1991, S. 23)
Des Weiteren spielen der Lernstoff und seine Aufbereitung bzw. Darbietung als Motivationsfaktoren eine Rolle.
Reichen (1991, S. 24 f.) widerspricht hierbei einigen als selbstverständlich geltenden Grundüberzeugungen, die angeblich zu einer optimalen Motivation der Schüler führen. Seine eigene Meinung sieht er durch verschiedene belegbare Sachverhalte begründet:
So lehnt er die gängige Meinung ab, dass Themeninhalte so geplant und gegliedert sein sollten, dass die Lernschritte und Kenntnisse aufeinander aufbauen und der Ablauf genau auf das angestrebte Ziel hin erfolgt.
Durch dieses Vorgehen wird zum einen der Unterrichtsgegenstand als Motivationsfaktor nicht genutzt. Zum anderen wird dabei durch den geringen Neuigkeitsgehalt der Inhalte Neugierde kaum gefördert. Weiterhin werden auf diese Weise kognitive Konflikte, die Präfigurationsprozesse* unterstützen könnten, weitgehend ausgeschaltet.
Das kleinschrittige Verfahren widerspricht zudem dem kindlichen Lernprozess, der sich häufig in Sprüngen vollzieht.
3.1.2 Werkstattunterricht als Teil eines besonderen Unterrichtsmodells
Reichen fordert keineswegs, den gesamten Unterricht auf Werkstattunterricht umzustellen. Vielmehr betrachtet er dieses Konzept lediglich als Teil eines Unterrichtsmodells.
Dies wird im Folgenden noch genauer erläutert; zunächst sollen jedoch die Hintergründe und Grundlagen, auf denen dieses besondere Unterrichtsmodell aufbaut, kurz skizziert werden.
Ausgangspunkt der Entwicklung des Modells bildet der Sachunterricht. Von besonderer Bedeutung sind dabei die beiden gegenläufigen Forderungen nach „Systematik“ bzw. „Offenheit“.
Die Hauptvertreter dieser beiden Richtungen sind Ausubel und Bruner, deren Überlegungen besonders für den Sachunterricht von Bedeutung sind. „Die Lernpsychologen David P. Ausubel und Jerome S. Bruner gehen beide von nahe verwandten theoretischen Ansätzen aus, ziehen daraus aber diametral entgegengesetzte pädagogische Forderungen: Bruner betont das entdeckende Lernen im offenen Unterricht, Ausubel ein begriffliches Gedächtnislernen im systematischen Unterricht“ (Reichen 1991, S. 46).
Im Aneignungsprozess des Entdeckungslernens bleiben systematische Erfordernisse letztlich sekundär. Dies bedeutet aber nicht, dass Bruner jede Systematik ablehnt. Er fordert zwar Offenheit, da das Entdeckungslernen im Zentrum seiner Lerntheorie steht, und dieses nur in offenen Unterrichtsformen möglich ist. In dem Lernangebot, das den Schülern in diesen offenen Unterrichtsformen unterbreitet wird, spielen jedoch systematische Erfordernisse eine ganz zentrale Rolle.
Ähnlich verhält es sich auch bei Ausubel: Er plädiert zwar für ein systematisch-chronologisches Lernen, lehnt aber Offenheit nicht ab. „Im Gegenteil: Offene Formen können im Lernangebot durchaus eine Rolle spielen, sofern die Aneignungsweise des Instruktionslernens nicht gestört wird“ (Reichen 1991, S. 53).
Reichen (1991, S. 53) führt weiterhin aus, dass man in der Theorie eine Zeitlang Instruktionslernen und Entdeckungslernen als Gegensätze angesehen hat, dass aber in der Praxis die beiden Konzeptionen undifferenziert vermischt wurden, und zwar in der denkbar schlechtesten Variante: die Folge war ein unsystematischer Frontalunterricht.
Erst seit Ende der achtziger Jahre hat sich hier ein Wandel angebahnt: „Die Didaktik [ist] auf dem Weg zu einer positiven Synthese: von Ausubel die Systematik, von Bruner das Entdeckungslernen“ (Reichen 1991, S. 53).
Reichen (1991, S. 54f.) vergleicht außerdem die Meinungen verschiedener Autoren zu diesem Thema. Er kommt dabei zu folgendem Schluss: „In der aktuellen schulpädagogischen Diskussion besteht also weitgehend Übereinstimmung darüber, dass offene und differenzierende Lernformen für den Elementarunterricht in besonderem Masse geeignet sind, auch wenn ihrer Planung und Durchführung noch häufig Unsicherheiten im Wege stehen“ (Reichen 1991, S. 55).
Das Problem liegt nach Reichen also vor allem darin, dass ein Großteil der Lehrerschaft nicht weiß, wie ein solcher Unterricht konkret verwirklicht werden könnte. Deshalb hat er versucht, ein Unterrichtsmodell zu entwerfen, das diesen Überlegungen entspricht (vgl. Reichen 1991, S.55).
Das Modell hat den Sachunterricht als Grundlage, hierauf baut es auf. Reichen erklärt dies damit, dass die Sachen als solche den Zugang zur Wirklichkeit eröffnen. Da die Wirklichkeit den wirkungsvollsten Faktor der Erziehung darstellt, sollte man sich möglichst eng an die Sachen halten, da man der Wirklichkeit so besonders nah kommt (vgl. Reichen 1991, S.55).
Das Unterrichtsmodell entspricht besonders der Forderung nach mehr Möglichkeiten zu selbständigem, handelndem Lernen der Schüler und damit den Grundsätzen des Individualisierens und der didaktischen Aktivierung (vgl. Reichen 1991, S. 55).
Reichen verdeutlicht den Aufbau des Modells durch folgende graphische Darstellung (siehe unten). Zu dieser Abbildung (Abb. 1) gibt er eine umfassende Erläuterung: Didaktisch steht ein umfassender Sachunterricht im Zentrum des Modells, bei dem es wirklich um die Sache gehen soll, d.h. um die Vermittlung von Sacheinsicht und Sachkenntnis: „Der Mathematikunterricht wird dann anwendungsorientiert, der Sprachunterricht kontext- und kommunikationsorientiert“ (Reichen 1991, S.56).
Methodisch stehen für den Sachunterricht, der sowohl Offenheit als auch Systematik beinhaltet und dem Schüler so eine handelnde und trotzdem systematische Erschließung der Umwelt ermöglichen will, drei Unterrichtsformen im Zentrum: Instruktionsunterricht*, Werkstattunterricht und Projektunterricht*.
Ihre Gewichtung verteilt sich folgendermaßen: Es dominiert der Werkstattunterricht, der den erforderlichen Instruktionsunterricht mit einschließt und durch einzelne Projekte ergänzt wird (vgl. Reichen 1991, S. 56):
- Instruktionsunterricht erfolgt meist frontal und dient zur Vermittlung systematischer Forderungen; es geht dabei meist um Einführungen, Orientierungen usw.
- Projektunterricht schafft dagegen ein Maximum an Freiraum für eigenes Handeln der Schüler: die Schüler werden dabei an der Planung und Vorbereitung der unterrichtlichen Vorhaben mitbeteiligt und übernehmen teilweise sogar die ganze Verantwortung.
- Werkstattunterricht bezeichnet ein offenes Arrangement von Lernsituationen und Materialien, bei dem die Schüler aus dem Lernangebot auswählen und teilweise auch eigene Ideen verwirklichen können. Die strukturierten Lernangebote für diese Form von Unterricht werden dabei mit dem Begriff „Lernwerkstätten“ bezeichnet.

Abbildung 1: Unterrichtsmodell (Reichen 1991, S.56)
Werkstattunterricht stellt bezüglich der Offenheit oder Systematik einen didaktischen Kompromiss dar: „Über die Zusammensetzung des (obligatorischen) Lernangebots nimmt die Lehrerin Einfluss auf die Erfordernisse der Systematik, in der Wahlmöglichkeit für die Schüler und im prinzipiellen Angebot eines „freien“ oder „leeren“ Postens entstehen Räume der Offenheit“ (Reichen 1991, S. 59).
Reichen weist jedoch darauf hin, dass diese drei Unterrichtsformen im Schulalltag kaum in reiner Form vorkommen, sondern entweder ineinander übergehen oder sich phasenweise ablösen. Gerade der Sachunterricht wird oft mit Instruktionsunterricht begonnen, um dann in Projekt- oder Werkstattunterricht überzugehen. Auf diese Weise erhalten die Schüler zunächst im Instruktionsunterricht einen Überblick und eine Grundlage, haben dann aber die Möglichkeit, darauf aufbauend selbstständig weiterzuarbeiten und dabei individuelle Schwerpunkte zu setzen (vgl. Reichen 1991, S. 59).
Neben dem Hauptunterricht beinhaltet das Unterrichtsmodell weitere Komponenten, die ebenfalls näher erläutert werden:
- Die begleitende Wiederholung des Grundwissens sollte weitgehend individuell erfolgen. Dies ist im Werkstattunterricht problemlos möglich, beispielsweise mit Hilfe von programmierten Übungen, einer Lernkartei oder auch Computerprogrammen.
- Die Zusatz- und Stützangebote ergänzen den Hauptunterricht in der Form, dass ihre Bearbeitung keine notwendige Voraussetzung für die Bewältigung des Hauptunterrichts darstellt.
- Der Rahmen gemeinsamer Erlebnisse soll das Gemeinschaftsgefühl der Klasse stärken. Hierzu zählen u.a. Ausflüge, Feste, sowie regelmäßige Geschichten- oder Fragestunden (vgl. Reichen 1991, S. 57).
Reichen (1991, S.57 f.) gibt weiterhin zahlreiche Empfehlungen zu verschiedenen Voraussetzungen, Bedingungen und Komponenten dieses Unterrichtsmodells. So verlangt ein solches Unterrichtsmodell beispielsweise ein spezifisches Lehrerverhalten, ist auf ein entsprechendes Lernangebot angewiesen und setzt einen bestimmten didaktischen Rahmen voraus.
Auf diese Punkte wird jedoch bei der Beschreibung des Werkstatunterrichtkonzepts noch näher eingegangen.
3.2 Ursprünge des Werkstattunterricht-Konzepts: Bezüge zur Reformpädagogik
Wie bereits dargestellt, baut das Konzept des Werkstattunterrichts auf ganz bestimmten Zielsetzungen und Forderungen auf. Diese basieren einerseits auf aktuellen Entwicklungen (vgl. 3.3 Aktuelle Begründungszusammenhänge). Andererseits sind die Forderungen, Ziele und auch die angewendeten Verfahren und Methoden nicht ganz neu; sie sind zu einem großen Teil bereits aus der Bewegung der Reformpädagogik bekannt.
Hier stellt sich nun einerseits die Frage, in welchen Punkten der Werkstattunterricht Reichens Bezüge zur Reformpädagogik aufweist. Des Weiteren ist die Frage zu klären, ob oder auch wie diese alten Forderungen und Verfahren der Reformpädagogik heute überhaupt noch gültig und sinnvoll sein können.
Zu diesem Zweck werden zunächst beispielhaft die Konzepte einiger „klassischer“ Reformpädagogen auf Parallelen zu Reichens Werkstattunterricht untersucht.
Es würde dabei allerdings zu weit gehen, die Programme der jeweiligen Pädagogen vollständig darzustellen, deshalb soll es genügen, lediglich die Schwerpunkte der verschiedenen Konzepte aufzuzeigen und dabei vor allem die Aspekte zu beleuchten, die in ähnlicher Form auch in Reichens Werkstattunterricht enthalten sind. Anschließend sollen dann allgemeine Forderungen und Grundsätze der Reformpädagogik mit denen Reichens verglichen und auf ihre Aktualität geprüft werden.
3.2.1 Parallelen bei verschiedenen Reformpädagogen
3.2.1.1 Parallelen bei Celestin Freinet (1896-1966)
Die Freinet-Pädagogik wurde in den 20er und 30er Jahren von dem französischen Volksschullehrer Celestin Freinet entwickelt. Er schuf ein praxisbezogenes Konzept zur Umgestaltung des Schulalltags, sowie „Arbeitstechniken“ und Lernmittel, deren bekanntestes die Schuldruckerei wurde. Er begründete außerdem eine Lehrerbewegung, die heute einige tausend Mitglieder in Frankreich, sowie Anhänger in über 30 Ländern in und außerhalb Europas umfasst (vgl. I. Dietrich 1995).
In Freinets Unterrichtskonzept finden sich zahlreiche parallele Ansichten, Forderungen und Verfahren, die auch Reichens Werkstattunterricht kennzeichnen.
So ist auch bei Freinet der Ausgangspunkt des Lernens der Kinder im Unterricht nicht eine vorbereitete Unterrichtsstunde, in der nach Vorgabe des Lehrers bestimmte Kenntnisse zu erwerben sind. Stattdessen wählen die Kinder aus einer Vielzahl angebotener Möglichkeiten ihre Tätigkeiten frei aus. „Wir bereiten ein erziehliches Milieu, ein Arbeitsmaterial, entsprechende Arbeitstechniken und eine Organisation der gesamten Arbeit vor, die es den Kindern erlauben, sich so weit als möglich selbst zu verwirklichen, wenn der Lehrer ihnen dabei hilft oder sie wenigstens bei ihren tastenden Versuchen und ihrem Forschen nicht hindert“ (Freinet 1965, S. 101).
Dies entspricht der Grundidee des Werkstattunterrichts nach Reichen. Von Bedeutung sind dabei vor allem auch die „Ateliers“, zu Deutsch „Werkstätten“: Hierbei handelt es sich um Arbeitsecken für handwerkliche oder auch geistige Arbeitsvorhaben. Diese Ateliers ähneln den verschiedenen Arbeitsbereichen, die im Werkstattunterricht abgeteilt werden. Den Kindern stehen hier bestimmte Arbeitsmaterialien zur Verfügung, mit denen sie selbständig arbeiten können.
Nach Freinet soll den Kindern die Möglichkeit gegeben werden, ihrem eigenen Wissensdrang nach zu lernen bzw. zu arbeiten. Er definiert den Begriff Arbeit deshalb folgendermaßen: „Von Arbeit sprechen wir immer dann, wenn das Tätigsein – ob physisch oder geistig – den natürlichen Bedürfnissen des Individuums entspricht und durch diese Tatsache allein schon eine gewisse Befriedigung verschafft. Im gegenteiligen Fall sprechen wir von Aufgabe und Pflicht, die man nur erfüllt, weil man dazu gezwungen wird“(Freinet 1979, S. 136).
Reichen (1991, S. 63) bestätigt: „Lernen ist primär ein individueller Vorgang. Daraus ergibt sich eine erste didaktische Grundforderung: Individualisierung des Lernens!“. Im Werkstattunterricht wird dieser Forderung einerseits zumindest teilweise durch die freie Wahl der Tätigkeit innerhalb des Angebots Rechnung getragen, zum anderen aber auch besonders durch die Einrichtung eines Leerangebots*, sowie durch die Möglichkeit, zu frei gewählten Themen Vorträge zu halten.
Wie Reichen forderte bereits Freinet, dass die Verschiedenartigkeit der Kinder in Bezug auf ihre Interessen, Fragestellungen, Veranlagungen oder Lern- und Arbeitsrhythmen im Unterricht beachtet werden sollte. „Wenn der Lehrer wirklich der Persönlichkeit jedes einzelnen Kindes in der Klasse gerecht werden will, ist es geradezu unmöglich, dass er zum selben Zeitpunkt von allen Kindern die gleiche Arbeit erwartet!“ (Baillet 1983, S. 23).
Freinet legt großen Wert auf die Selbstverantwortung der Kinder, insbesondere auch auf die Selbstverantwortung für ihre Arbeit. Die Schüler sollen deshalb lernen, ihre Arbeit selbst zu organisieren.
Hierzu dient u.a. die Einführung individueller Arbeitspläne (Tages-, Wochen- oder Monatspläne). Die Kinder sollen dadurch lernen, ihre eigene Arbeit zu planen und auch selbst zu beurteilen (vgl. Baillet 1983, S. 24). Analog gibt es im Werkstattunterricht ebenfalls Wochenpläne*, Arbeitskarten* oder Lernverträge*, die die gleichen Ziele verfolgen.
Auch die Selbstbeurteilung* und Selbsteinschätzung der eigenen Leistungen durch das Kind wird sowohl von Freinet, als auch von Reichen gefordert. Freinet gab hierfür spezielle Selbstkorrekturhefte heraus und führte nach Beendigung eines Arbeitsplans eine Arbeitsrückschau, die Bilanz, durch, bei der jeder Schüler den anderen von der geleisteten Arbeit berichtet (vgl. Baillet 1983, S. 253).
Die Übernahme von Verantwortung im Klassenverband spielt in der Freinet-Pädagogik ebenfalls eine tragende Rolle. Im Werkstattunterricht wird diese besonders durch die Einrichtung des Chefsystems* verwirklicht, wobei jeder Schüler das Amt eines Chefs übernimmt. Tatsächlich praktizierte auch Freinet schon die Einrichtung verschiedener Ämter (Responsabilités), durch die an die Schüler Verantwortlichkeiten verteilt wurden. Auf diese Weise wird jedes Kind zu einem wichtigen, verantwortlichen Glied der Klasse.
Freinets Kernstück der kooperativen Organisation, der Klassenrat mit seiner weitreichenden Entscheidungsmacht, kommt jedoch in Reichens Werkstattunterricht nicht vor.
Zusammenfassend lassen sich folgende Übereinstimmungen feststellen: Sowohl Freinet als auch Reichen ziehen eine Unterrichtsorganisation vor, in der den Schülern eine vorbereitete Umgebung zur Verfügung gestellt wird, innerhalb der sie ihre Tätigkeiten selbst wählen können. Die Individualisierung des Unterrichts steht dabei im Mittelpunkt. Außerdem wird großer Wert darauf gelegt, dass die Kinder Selbstverantwortung übernehmen.
Freinet geht jedoch in zwei Punkten noch einen Schritt weiter: Während bei Reichen innerhalb der Werkstatt ein Großteil der Aufgaben vorgegeben ist, sollen die Schüler bei Freinet ihre Arbeitsvorhaben selbst wählen, ihnen wird hierbei lediglich das Material zur Verfügung gestellt. Weiterhin ist es Reichen vor allem wichtig, dass die Kinder Selbstverantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen, Freinet dagegen möchte die Selbstverantwortung auch als politische Verantwortung für mehr Demokratie fördern.
3.1.1.2 Parallelen bei Hugo Gaudig (1860 – 1923)
Hugo Gaudig war neben Georg Kerschensteiner ein bekannter Vertreter der Arbeitsschulbewegung. Er konzipierte jedoch eine Arbeitsschule, die kontrastierend zu der Kerschensteiners, andere Akzente setzte. Im Mittelpunkt der Erziehung stand eine von ihm so genannte „Persönlichkeitspädagogik“, bei der er viel Wert auf die Selbsttätigkeit der Schüler in jeder Hinsicht legte, d.h. im Gegensatz zu Kerschensteiner auch im Bezug auf kognitiv-begriffliche Aspekte. Daneben setzte er einen Schwerpunkt auf die Vermittlung von Arbeitstechniken, wobei er wiederum vor allem die geistigen Techniken bedachte (vgl. Bast 1996, S. 87 ff.).
Für Hugo Gaudig stand die Selbsttätigkeit des Kindes im Zentrum aller pädagogischen Bemühungen. Dieses Prinzip hat er durchdacht und planmäßig den Unterricht darauf aufgebaut: „Selbsttätigkeit fordere ich für alle Phasen der Arbeitsvorgänge. Beim Zielsetzen, beim Ordnen des Arbeitsvorganges, bei der Fortbewegung zum Ziel, bei den Entscheidungen an kritischen Punkten, bei der Kontrolle des Arbeitsganges und des Ergebnisses, bei der Beurteilung soll der Schüler selbsttätig sein“ (Gaudig 1922, S. 93).
Die Kinder sollen sich ihr Arbeitsziel selbst stecken, einen Arbeitsplan aufstellen, den Arbeitsprozess beginnen und durchführen und ihr Arbeitsergebnis prüfen; kurz: Sie sollen Selbstverantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen (vgl. Gaudig 1922, S. 89 f.). Wie schon bei Freinet aufgezeigt, ist dies auch das Anliegen Reichens.
Entsprechend stimmen auch die Vorstellungen betreffend der Aufgaben des Lehrers überein: Gaudig sieht in dem Lehrer einen Organisator des Lernens; er soll nicht allein, dozierend und vermittelnd den Unterricht führen, sondern stattdessen die Rolle eines Helfers übernehmen, der soweit wie möglich zurücktritt, um den Schülern selbständiges Arbeiten zu ermöglichen: „Sich entbehrlich, sich überflüssig zu machen muss das ernsteste Ziel des Lehrers sein, der selbsttätige Köpfe bilden will“ (Gaudig 1909, S. 174 f.). Diese Meinung vertritt auch Reichen, wenn er fordert: „Didaktische Zurückhaltung ist bei der Lehrerin die wohl entscheidendste Voraussetzung, um den Schülern ein selbstgesteuertes Lernen zu ermöglichen“(Reichen 1991, S. 82).
Gaudig legt weit mehr Wert auf die Vermittlung von Arbeitstechniken anstatt von lernbaren Gewissheiten. Er sieht deshalb einen Schwerpunkt in der Förderung von methodischen Strategien, mit deren Hilfe sich die Schüler selbst neue Inhalte aneignen können. Dies ist die Grundlage, durch die selbständiges Arbeiten der Kinder erst möglich wird (vgl. Bast 1996, S. 93).
Auch hier stimmt Reichen mit Gaudig überein: „Selbsttätigkeit und eigenes Erfahren müssen [...] auch deshalb an oberster Stelle stehen, weil Kinder (wie übrigens auch die Erwachsenen) nur durch eigenen handelnden Umgang taugliche Methoden zu einer selbständigen Welterschließung gewinnen können“ (Reichen 1991, S. 44).
Eine weitere Entsprechung besteht in der Auffassung von dem Prinzip der Anschaulichkeit.
Gaudig sieht in diesem Prinzip die „Herstellung des unmittelbaren Verkehrs zwischen Kind und Weltwirklichkeit“. „Anschauen“ ist für ihn kein passives Geschehen, sondern, richtig verstanden, ein „Arbeitsvorgang“, bei dem „das Kind am Anschaubaren arbeitet[...]“ (Gaudig 1922, S. 118 f.).
Ebenso kritisiert Reichen (1991), dass „das historisch überlieferte Anschauungsprinzip […] von einer Passivität des erkennenden, bzw. wahrnehmenden Menschen aus[geht]“, und fügt hinzu: „Wirkliche Anschauung entsteht vielmehr im Umgang mit dem angeschauten Objekt [...]“. (S. 45)
Insgesamt weisen Gaudigs Vorstellungen von Unterricht und Erziehung zahlreiche Gemeinsamkeiten mit denen Reichens auf. Zum einen sind für beide die Selbsttätigkeit der Schüler und die Selbstverantwortung für das eigene Lernen von sehr hoher Bedeutung.
Zum andern stimmen ihre Forderungen bezüglich der Rolle und der Aufgaben des Lehrers im Unterricht überein; sie sehen ihn beide als einen Organisator der Lernbedingungen.
Ebenso vertreten sie die gleiche Auffassung des Anschauungsprinzips und verfolgen dadurch auch in diesem Zusammenhang ähnliche Ziele.
Gaudigs zentrales Anliegen, den Schülern verschiedene Arbeitstechniken zu vermitteln, wird zwar von Reichen geteilt, für Gaudig steht dieser Aspekt jedoch noch mehr im Zentrum seiner Unterrichtsorganisation als das bei Reichen der Fall ist.
3.2.1.3 Parallelen bei Maria Montessori (1870 – 1952)
Die italienische Ärztin Maria Montessori sah das Kind als Ausgangspunkt aller Erziehungs- und Unterrichtsmaßnahmen an. Damit vertrat sie eine ausgesprochene Pädagogik vom Kinde aus. Sie kämpfte gegen die gesellschaftliche Vernachlässigung von Kindern und gründete zahlreiche Kindergärten und Kinderhäuser. In diesen wurde das von ihr entworfene didaktische Lehrmaterial verwandt, das die Schüler zur „Polarisation der Aufmerksamkeit“ und dadurch zur „Normalisation“ führen sollte.
Entscheidend waren für sie das Eingehen auf die Wachstumsgesetze des Kindes (die „sensiblen Perioden“), sowie die bewusste Entwicklung seiner Selbsttätigkeit und Selbsterziehung. Montessoris Methode fand schließlich auch in Deutschland Anerkennung; so wurden auch hier zahlreiche Montessori-Kindergärten und –Schulen gegründet. (vgl. Scheibe 1978, S. 55 f.)
Wenn man auch im ersten Moment vielleicht nicht allzu viel Gemeinsames mit Montessoris Unterrichtskonzept und dem Werkstattunterricht Reichens verbindet, so finden sich doch bei genauerer Betrachtung auch hier einige grundlegende Gemeinsamkeiten.
Nach Kratochwil (1992, S. 128) lassen sich bei sorgfältiger Analyse von Montessoris Werk folgende pädagogisch-didaktischen Grundsätze ausmachen:
- Die Aktivierung der Kinder, sowie die Förderung der Selbsttätigkeit; beispielsweise durch die „freie Wahl“ des Materials und damit der Lernaufgaben.
- „Begrenzung des Einschreitens“ (Montessori 1965, S. 38, zitiert nach Kratochwil 1992, S. 128), d.h., dem Kind nur zu helfen, wenn es danach verlangt und dann auch nur soweit, dass es selbst weitermachen kann.
- Individualisierung.
- Berücksichtigung physiologischer, physischer und psychischer Bedürfnisse
- Veranschaulichung, Aktivierung der Sinne.
Diese Grundsätze stimmen ausnahmslos mit denen überein, die Reichens Werkstattunterricht zugrunde liegen. Besonders deutlich sind die Ähnlichkeiten bei den ersten beiden Punkten: Die freie Wahl der Arbeit aus einem vorbereiteten Angebot ist das entscheidende Prinzip des Werkstattunterrichts; hierauf baut er auf.
Der zweite Punkt stellt die deutlichste Entsprechung dar: Er beruht auf der bedeutsamen Kindesäußerung „Hilf mir, es selbst zu tun“, die für Montessori zu einem Kernstück ihres Konzepts wurde. Die dahinter stehende Idee des begrenzten Einschreitens entspricht exakt dem von Reichen propagiertem „Prinzip der minimalen Hilfe*“ (Reichen 1991, S. 83).
Die Gemeinsamkeiten von Reichens Werkstattunterricht und der Montessori-Pädagogik liegen demnach vor allem in den kindbezogenen theoretischen Grundsätzen.
In der konkreten Unterrichtspraxis finden sich dagegen bei Montessori teilweise sehr spezielle Elemente, die im Werkstattunterricht nicht vorkommen. Zu nennen ist hier vor allem das Montessori-Material, das in ihrer Methode eine ganz entscheidende Rolle spielt.
3.2.2 Allgemeine Forderungen der Reformpädagogik und ihre Übernahme in den Werkstattunterricht
Der Bewegung der Reformpädagogik werden eine Reihe von Pädagogen und ihre jeweils speziellen Konzepte zugeordnet, die eine Fülle von Versuchen, Ideen und Forderungen beinhalten. Bestimmte Ziele und Forderungen tauchen jedoch immer wieder auf und verbinden die einzelnen Ideen und Konzepte miteinander. Sie wurden deshalb als allgemein reformpädagogische Forderungen bekannt. Gerade hier findet sich vieles, worauf auch Jürgen Reichen seinen Werkstattunterricht aufbaut. Da es dabei vor allem um Aspekte der Methodik geht, werden schulstrukturelle und schulpolitische Anregungen der Reformpädagogik im Folgenden vernachlässigt.
Zahlreiche Autoren haben versucht, die allgemeinen Forderungen und Grundsätze der Reformpädagogik thesenartig zusammenzustellen. Diese Listen sind betreffend ihres Inhaltes sehr ähnlich, deshalb genügt es, beispielhaft die Forderungen nur einer solchen Zusammenstellung mit denen Reichens zu vergleichen, und diese lediglich durch einige Ergänzungen abzurunden.
Hans-Jürgen Ipfling (1992, S. 14) stellt acht Grundideen der Reformpädagogik zusammen:
- Lernen in Zusammenhängen: Nicht nur lehrganghaftes, nach Fächern aufgegliedertes Lernen.
- Die Bedeutung der Emotionen - Freude statt Angst.
- Förderung der Kooperation untereinander, nicht nur Konkurrenzdenken.
- Die Lebensbedeutsamkeit des Lernens sollte sichergestellt werden.
- Lernen mit Kopf, Herz und Hand; ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen.
- Bildung von Verantwortungsgefühl als Ziel; Lernen nicht nur zum Wissenserwerb.
- Offenheit des Lernens für Aktuelles oder Unvorhergesehenes.
- Einbeziehen außerschulischer Lernorte.
Diese Grundideen lassen sich ausnahmslos auch Reichens Werkstattunterricht zuordnen:
- Lernen in Zusammenhängen: Nicht nur lehrganghaftes, nach Fächern aufgegliedertes Lernen: Werkstattunterricht eignet sich sehr gut für fächerverbindendes Lernen. Meistens wird zu einem bestimmten Thema eine Werkstatt durchgeführt, die verschiedene Aspekte der Thematik mit ganz unterschiedlichen Fachbezügen enthält. Dadurch, dass der eigentliche Sachverhalt im Vordergrund steht und nicht die einzelnen Fächer, wird ein Lernen in Zusammenhängen ermöglicht. Die Schüler lernen dabei automatisch nicht lehrganghaft, Schritt für Schritt, sondern können ihren Lernweg selbst bestimmen.
- Die Bedeutung der Emotionen - Freude statt Angst: Reichen (1991, S. 22) beachtet ebenfalls die Bedeutung von positiven Emotionen beim Lernen sowie auch den Einfluss von Stress oder Angst: eine angenehme Unterrichtsatmosphäre sieht er als Grundlage jeden Unterrichts an. Er geht jedoch noch einen Schritt weiter und fordert nicht nur eine freundliche, sondern vor allem eine fördernde Lernatmosphäre. Damit meint er, dass die Lernatmosphäre zwar emotional positiv sein, aber dennoch sinnvolle, d.h. begründbare Belastungen bieten sollte: „Die Lernsituation sollte frei von Spannungen sein, die durch Zwang, Druck und soziale Ängste hervorgerufen werden, nicht aber von aufgaben- oder leistungsbezogenen Zielspannungen, wie sie etwa durch kognitive Konflikte [...] und Wettbewerb gesetzt sind“ (Reichen 1991, S.22).
- Förderung der Kooperation: Auch im Werkstattunterricht spielt die Gemeinschaftsbildung eine große Rolle. Forderten bereits die Reformer die „Überwindung der zerstörerischen Konkurrenzmechanismen in der Schule“ (Flitner 1999, S. 245), so bekräftigt auch Reichen (1991, S. 63): “Der Sozialeinbettung des Lernens im Mit- und Voneinanderlernen kommt höchste Bedeutung zu“. Im Werkstattunterricht werden Kooperation und soziales Lernen besonders durch das Chefsystem*, sowie auch durch den Helferunterricht* gefördert. Durch diese Prinzipien ermöglicht Werkstattunterricht, „dass Kinder von ihren Kameraden lernen bzw. die Kameraden lehren, was lernpsychologisch beides höchst wirkungsvoll ist. [...] [So] lernen sie auch, andere besser zu verstehen und sich solidarisch-unterstützend zu verhalten. Sie lernen ihre eigenen Ansprüche anzumelden und durchzusetzen, bei gleichzeitiger Rücksichtnahme auf Ansprüche der anderen“(Reichen 1991, S. 74).
- Die Lebensbedeutsamkeit des Lernens: Besonders bei Reichens Ausführungen über den Sachunterricht wird seine Forderung nach der Lebensbedeutsamkeit des Lernens deutlich. So sieht er den Auftrag des Sachunterrichts bereits in einem Zitat von Johannes Kühnel aus dem Jahr 1907 treffend dargestellt: „der Elementarunterricht solle im Wesentlichen Sachunterricht sein und seine Stoffe aus dem Menschen- und Naturleben, wie es sich abspielt innerhalb des geistigen Horizonts des Kindes oder an seinen Grenzen entnehmen“ (zitiert nach Reichen 1991, S.31). Daneben sieht Reichen die Bedeutung der Lebensnähe auch in Verbindung mit der Gedächtnisleistung. Durch die Lebensnähe bekommen die Kinder einen Bezug zum Lerngegenstand und können sich die Dinge deshalb besser merken. „Werden reale Erlebnisse angesprochen, so wird der Lerninhalt eingängiger, und bei der anschließenden Verfestigung des Gelernten wirkt dann die reale Umwelt unentgeltlich als unbemerkte Nachhilfelehrerin, indem sie das Gelernte zum Mitschwingen bringt“(Reichen 1991, S. 29).
- Lernen mit Kopf, Herz und Hand; ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen: Auch diese Forderung ist in Reichens Werkstattunterricht-Konzept enthalten. Werkstattunterricht versteht sich als ein Versuch, der Kopflastigkeit des frontalen Unterrichts und der Passivität des Schülers entgegenzuwirken. So fordert Reichen (1991, S. 58), das bereitgestellte Lernangebot „müsste
- ganzheitlich sein in dem Sinn, dass es Sensomotorisches, Soziales, Kognitives und Emotionales verbindet
- die Sinnesorgane aktivieren
- zum Handeln anregen
- [...]“.
- Bildung von Verantwortungsgefühl als Ziel; Lernen nicht nur zum Wissenserwerb: Die Förderung des Verantwortungsgefühls spielt im Werkstattunterricht besonders beim Chefsystem* eine tragende Rolle. Hier hat jeder Schüler seine Aufgabe, für die er selbst die Verantwortung trägt und die er gewissenhaft erfüllen muss, damit der Unterricht funktioniert. Als ein weiteres wichtiges Ziel sieht Jürgen Reichen (1991, S. 17), dass die Schüler Selbstverantwortung für ihr Lernen übernehmen. Deshalb setzt er Arbeitskarten*, Wochenpläne* oder Lernverträge* ein, mit denen die Schüler eine Vorauswahl* treffen können. „[...] Anstatt mechanisch zu reproduzieren, weiß jeder Schüler, was er lernen soll, auf welche Weise und zu welchem Zweck“. Die Schüler lernen auf diese Weise auch, ihre eigene Lernentwicklung und die eigenen Stärken und Schwächen einzuschätzen. Ebenso fordert Reichen (1991, S. 34), dass Lernen nicht nur aus reinem Wissenserwerb bestehen sollte. Werkstattunterricht soll die Schüler darüber hinaus u.a. zu Selbständigkeit erziehen und ihre sozialen Kompetenzen fördern. Besonders betont Reichen, dass es sehr wichtig ist, das Lernen zu lernen. Dem Kind sollen in der Schule Fähigkeiten und Arbeitstechniken vermittelt werden, mit deren Hilfe es sich die Welt aneignen, seine Erfahrungen ordnen und immer wieder Neues dazulernen kann. „Idealerweise soll das Kind in der Grundschule Formen der symbolischen Aneignung und Verarbeitung von Wirklichkeitserfahrungen erlernen und weiterentwickeln“.
- Offenheit des Lernens für Aktuelles oder Unvorhergesehenes: Einer der großen Vorteile des Werkstattunterrichts ist seine Flexibilität. Da er von vornherein nicht durchgängig und schrittweise geplant ist, deshalb kann man während des Unterrichts relativ problemlos auf unvorhergesehene Ereignisse eingehen. Ebenso können auftretende Fragen oder Probleme einzelner Schüler während des Unterrichts geklärt werden, ohne dass die anderen Schüler dadurch in ihrer Arbeit gestört werden. Das Lernangebot einer Werkstatt kann auch mit der Klasse zusammen geplant und auf ihre Interessen und Wünsche abgestimmt werden. Aktuelle Bedürfnisse der Schüler können darüber hinaus in der Bearbeitung des Leerangebots* einen Platz finden.
- Einbeziehen außerschulischer Lernorte: Reichen (1991, S. 86) fordert ausdrücklich, dass immer wieder zumindest einzelne Lernangebote einer Werkstatt aus dem Klassenzimmer hinausführen sollten. Er stellt weiterhin die Bedeutung der Originalbegegnung heraus und fordert dementsprechend, dass die Lerngegenstände möglichst in der Wirklichkeit angeschaut werden sollten (vgl. Reichen 1991, S. 45).
Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe weiterer reformpädagogischer Forderungen, die den Zielen entsprechen, die Reichen im Werkstattunterricht verwirklichen möchte:
Selbstgesteuertes Lernen und die Beachtung der Individualität der Schüler waren grundlegende Forderungen der Reformpädagogik. Im Werkstattunterricht stehen sie ebenfalls im Mittelpunkt des Unterrichts. Die Schüler können entscheiden, wann sie welches Angebot bearbeiten; sie haben die Möglichkeit, selbst über Zeitpunkt, Lerntempo und Sozialformen ihrer Arbeit zu bestimmen und können darüber hinaus auch individuellen Interessen nachgehen: „Die drei Grundforderungen
- Individualisierung des Lernens
- Individualisierung und Gemeinschaftsbildung
- breit gefächertes Lernangebot
können mit und im Werkstattunterricht besonders gut eingelöst werden. Und darin liegt sein Hauptzweck: Er macht es möglich, das pädagogisch-didaktische Grundprinzip der Individualisierung gemeinschaftlich und fächerübergreifend zu verwirklichen“ (Reichen 1991, S. 63).
Reichen (1991, S. 61) vertritt die pädagogische Grundüberzeugung, dass fast jedes Kind neugierig und lernwillig in die Schule kommt und die geforderten Lernziele von sich aus erreichen kann, wenn es richtig angeregt und angeleitet wird.
In der Reformpädagogik vertraute man ebenfalls auf das Lernbedürfnis der Kinder, auf die in jedem Menschen vorhandenen Kräfte. Umschrieben wurden diese mit folgenden Formulierungen: „die Seele als ein tätiges und hervorbringendes Wesen“ (Rousseau), „eine in mir wohnende Strebekraft“ (Pestalozzi) oder „innerer Bauplan der Seele“ (Montessori). (vgl. Potthoff 1994, S. 83).
Ausgehend von der Neugierde und dem natürlichen Lernbedürfnis der Kinder fordert Reichen selbstgesteuertes Lernen sowie möglichst viel Lernen durch intrinsische Motivation*.
Bereits Rousseau lehrte, dass die Triebfeder für alles Lernen das Interesse des Lernenden an der Lernsache sein muss. Wagenschein ging deshalb mit seinen Schülern von den Phänomenen aus, und auch Kilpatricks Projektunterricht versuchte, an die Interessenlage des einzelnen Schülers anzuknüpfen (Potthoff 1994, S. 75).
Im Werkstattunterricht wird diese Forderung insbesondere durch die Einrichtung eines Leerangebots* erreicht, sowie durch die Möglichkeit, freie Vorträge zu selbstgewählten Themen vorzubereiten und zu halten.
Werkstattunterricht beruht demnach auf wichtigen Prinzipien der Reformpädagogik. Ein Großteil der Forderungen, die die Reformpädagogik an Unterricht und Erziehung stellte, vertritt auch Reichen. Umgekehrt lassen sich beinahe alle Ziele, die Reichen verfolgt, auch der Bewegung der Reformpädagogik zuordnen. Dies führt jedoch zu der Frage, inwiefern das Werkstattunterrichtskonzept in der heutigen Zeit aktuell ist.
3.2.3 Zur Aktualität reformpädagogischer Forderungen
Nachdem deutlich wurde, dass ein Großteil von Reichens Prinzipien und Grundideen aus der Reformpädagogik stammen oder denen der Reformpädagogik entsprechen, soll nun geprüft werden, ob und warum die dort gestellten Forderungen heute noch oder wieder aktuell sein können bzw. in welcher Richtung sie verändert werden müssten.
Zahlreiche Autoren weisen heute auf den Wert und Ertrag der Reformpädagogik hin und bekräftigen ihre Berechtigung und Leistungsfähigkeit in der heutigen Zeit (vgl. Potthoff 1994; Reble 1992; Zimmermann 1994). Beispielsweise meint Potthoff (1994, S. 65) hierzu: „Wer Erziehung und Unterricht an den Schulen humanisieren und dabei zugleich das Lernen an den Erfordernissen des gesellschaftlichen, beruflichen und privaten Lebens orientieren und seine Effizienz steigern will, darf den Ertrag der klassischen Reformpädagogik nicht außer Acht lassen. Die pädagogischen Entwürfe der Jahre von 1890 bis 1932 enthalten eine erstaunlich große Fülle an Impulsen und konkreten Hilfen für die schwierigen Situationen, die sich an den heutigen Schulen ergeben.“
Er begründet dies damit, dass zahlreiche Strukturmerkmale des derzeitigen Wandels in diesen Umbruchjahren ihren Ursprung haben und schon damals zu pädagogischen Antworten herausforderten.
Auf diesen Begründungszusammenhang weist auch Reble (1992, S. 17 ff.) hin. Der Zeitgeist des 19. Jahrhunderts wurde geprägt von verschiedenen Veränderungen der Gesellschaft und der Wirtschaft, die denen der heutigen Zeit sehr ähnlich sind. Bis zum Ende des Jahrhunderts wurden der allgemeine Fortschritt und das Wirtschaftswachstum weitgehend nur positiv eingeschätzt. Erst dann begann man, auch Nachteile dieser Entwicklung zu sehen; dass der Fortschritt den Menschen zwar äußerlich fördert, aber innerlich bedroht; dass die einseitige Betonung von Verstand, Naturwissenschaften und Technik seine inneren Kräfte und Werte zu kurz kommen lässt. Bast bestätigt ebenfalls die These, dass „[...] wir offenbar vor ähnlichen Problemen stehen wie die Gesellschaft um die Jahrhundertwende, wenn man gewillt ist, der derzeitigen zweiten industriellen Revolution ähnliche mentalitätsverändernde Wirkungen zuzuschreiben wie der am Beginn des 20. Jahrhunderts. Damals wie heute besteht die pädagogische Aufgabe dann darin, die mit der Modernisierung einhergehenden Prozesse der Emanzipation des einzelnen, der Freisetzung des Subjekts von Verbindlichkeiten zu unterstützen und zu begleiten – gleichzeitig aber auch die Kehrseite der Moderne wie Vereinzelung, Entfremdung, Verdinglichung und Ausgeliefertsein des Einzelnen an die Superstrukturen pädagogisch aufzufangen“ (Bast 1996, S. 7).
Aus diesem Ansatz heraus entstanden konkrete Forderungen nach der Änderung des Erziehungsstils der Schulen:
- sie sollte mehr zum praktischen Leben hinführen und daneben einen Gegenpol zu der derzeitigen Entwicklung bilden
- sie sollte der intellektuellen Einseitigkeit des Gesamtlebens entgegensteuern und die inneren Anlagen und Möglichkeiten des Menschen umfassender fördern.
Vergleicht man nun unsere heutige Situation mit der damaligen, so ist die Ausgangslage nicht einfacher geworden: „Die einseitig-industriell bestimmte gesellschaftliche Gesamtentwicklung mit Massenexistenz, Atomisierungs- und Veräußerlichungstendenz ist inzwischen weitergegangen, hat sich sogar noch verschärft und mit ihr der ganze Problem- und Gefahrenkomplex, der damals schon an dieser Entwicklung hing und viele Menschen beunruhigte“ (Reble 1992, S. 26).
Die Gesamtsituation des Kindes in der Gesellschaft ist eher noch komplizierter geworden. Einige der Lebensumstände und Probleme, die die Reformpädagogik bereits anführte, existieren weiter und sind teilweise noch gravierender geworden. Manche Lebensprobleme haben sich gewandelt, und es sind neue dazugekommen (vgl. 4.1 Wandel der Kindheit).
Aus der Erkenntnis der Wirtschaft heraus, dass ein großes Maß an statischem Wissen nicht ausreicht, um die zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit erforderlichen Innovationen voranzubringen (siehe auch Kulturrevolution), werden heute neben einer guten Wissensbasis Schlüsselqualifikationen* gefordert. Potthoff (1994, S. 70) weist dabei auf einen interessanten Aspekt hin: „Was aber gefordert wird:
- Entscheidungsfähigkeit
- Selbstständigkeit
- Kritikfähigkeit
- Urteilsfähigkeit
- Fähigkeit zum autonomen Lernen
- Kooperationsfähigkeit
- Teamgeist
- Kommunikationsfähigkeit
- Organisationsfähigkeit
- Fähigkeit zum vernetzen Denken
sind ausnahmslos (wenn auch zum Teil mit anderen Worten ausgesprochene) Forderungen der Reformpädagogik mit ihrem Ziel der Persönlichkeitsbildung innerhalb der Gemeinschaft“.
T. Dietrich (1992, S. 48) bestätigt diese Parallelität. Er bekräftigt, dass es heute aus personalen und gesellschaftlichen Gründen unabdingbar ist, die Aktivität, das Selbstdenken und die Kommunikationsfähigkeit der Schüler zu fördern. Dies forderten bereits die Reformpädagogen, ganz im Gegensatz zur „Stoffschule“ des 19. Jahrhunderts.
Das Lernen in der Schule soll nicht allein zum Wissenserwerb dienen. Diese reformpädagogische Forderung erhält in der Gegenwart neue Bedeutung.
Der Mensch ist heute von vielen Bindungen befreit. Dies bringt jedoch auch die Forderung mit sich, dass er lernen muss, mit dieser Freiheit umzugehen (vgl. Hensel 1995, S. 32 f.). Ziel der Erziehung muss es deshalb sein, den jungen Menschen zunächst die Sicherheit für selbstverantwortete freie Entscheidungen zu geben. Die gegebene Freiheit kann nämlich auch drastisch eingeschränkt werden, und zwar nicht nur durch mangelndes Wissen, sondern auch durch das Fehlen von Arbeitstechniken, Wertesystemen oder Sinnhorizonten. „Um die Freiheit der Wahl nutzen zu können, müssen verschiedene Alternativen, ‚Leitbilder des Lebens’, bekannt sein, zwischen denen zu wählen ist oder neben denen der eigene Weg ausgebaut werden kann“ (Potthoff 1994, S. 67).
Individualität und Selbststeuerung des Lebens nehmen immer mehr zu, vorgezeichnete Lebenswege gibt es immer weniger; die Menschen müssen deshalb zunehmend Selbstverantwortung für ihren eigenen individuellen Lebenslauf übernehmen. Das Erfahren der eigenen Persönlichkeit hat daher ungeheuren Wert für junge Menschen von heute. Auch aus diesem Grund wird ersichtlich, dass eine bloße Wissensvermittlung als Aufgabe der Schule von heute nicht ausreicht, und dass die Reformpädagogik auch zu diesem Punkt verschiedene Ergänzungen geben kann.
„Wer ausschließlich das abfragbare stoffliche Wissen als Schulziel betrachtet, kann von der Reformpädagogik vielleicht einige interessante Methoden für die Effektierung des Lernens übernehmen. Wer darüber hinaus über die Bildung des Individuums zur Persönlichkeit und zum voll verantwortlichen Glied unserer Gesellschaft anregen will, findet in der Reformpädagogik eine unermessliche Fülle an beachtenswerten Gedanken“ (Potthoff 1994, S. 66).
Die Forderungen der Reformer nach Lernen mit allen Sinnen, dem Einbezug des Körpers und der Ermöglichung von direkten Erfahrungen bekommen in der heutigen Zeit durch ganz neue Problemfelder, vor allem durch den enorm gesteigerten Medienkonsum einen Bedeutungszuwachs. Des Weiteren werden verschiedene Forderungen der Reformpädagogik durch neue Erkenntnisse der Lernforschung und der konstruktivistischen Didaktik bestätigt und weiter entwickelt: Das eben angesprochene ganzheitliche Lernen und die damit verbundene Forderung, bei den Schülern möglichst viele Sinne anzusprechen und alternative Lernwege zu ermöglichen, entsprechen empirischen Ergebnissen der Lernforschung. Dabei kommt es, wie Reich in seiner „Konstruktivistischen Didaktik“ zusammenfasst nicht nur auf Rekonstruktionen, sondern vor allem auf Konstruktionen in Handlungen an, die das klassische Bild des Frontalunterrichts allenfalls noch als einen Sonderfall erfolgreichen Lernens ausweisen.
Von der Psychologie wurden zudem sehr individuelle Leistungskurven von Lernern nachgewiesen. Daher ist ein Lernen nach einem eigenen individuellen Rhythmus mit seinen Leistungs- und Müdigkeitskurven so wichtig, sowie auch die Abwechslung zwischen verschiedenen Phasen des Aufnehmens, Verarbeitens und Sich-Ausdrückens, zwischen geschlossenen und freien, aktiven und passiven Phasen.
Wie bei Reichen steht die Individualisierung des Lernens im Mittelpunkt der gegenwärtigen Forderungen aus konstruktivistischer Sicht. Stärker als in der Reformpädagogik wird hier allerdings auch auf die partizipatorische Seite gesehen, wie sie vor allem von John Dewey vorbereitet wurde (vgl. Demokratie im Kleinen).
Didaktische Praktiker können die Forschungen in ihrer Praxis oft bestätigen. Wie wichtig ein Handlungsbezug ist, das schreibt z.B. Dietrich (1992, S. 38 ff.). Er vergleicht ein lerntheoretisch reformpädagogisch konzipiertes Unterrichtsbeispiel mit dem Verlauf einer Lektion nach dem Frage-Antwort-Verfahren zum gleichen Thema und untersucht dabei die Effektivität des Lernens. Bei dem ersten offenen Unterrichtsbeispiel arbeiten die Schüler handlungsorientiert in verschiedenen Sozialformen, sie entdecken das Entscheidende selbst und gelangen so auch genetisch und weitgehend selbsttätig zum Verstehen. Beim zweiten Beispiel geht die Lehrerin fragend-aufbauend in kleinen Schritten vor. Die Schüler arbeiten auch hier lebhaft mit: sie melden sich und antworten, schauen aufmerksam zu und schreiben am Ende das Tafelbild ab. Als er nach einem Dreivierteljahr eine Kontrolle der Kenntnisse in den beiden Klassen durchführt, kommt Dietrich zu einem interessanten Ergebnis: Hatte die erste Klasse den größten Teil der Informationen behalten, so hatte die zweite Klasse alles vergessen.
Dietrich (1992, S. 41) folgert daraus: „Selbsttätiges, handlungsorientiertes, entdeckendes und genetisches Lernen ist bleibend und steht für weitere Lernprozesse zur Verfügung, weil ein Denk- und Handlungsfeld relativ selbständig strukturiert und die Einsicht weitgehend selbständig gewonnen wird. Beim assoziativen Lernen oder beim Lernen in kleinen Schritten wird die Erkenntnis durch das „Gängelband“ des Lehrers „herbeigeführt“, geht aber in der Regel sehr rasch wieder verloren.“
Er gibt aber auch zu, dass sich die benötigte Zeit in den beiden Klassen stark voneinander unterschied (dreimal 1 ½ Stunden gegenüber 50 Minuten!). Deshalb bleibt heutzutage durch die Lernplananforderungen oft kaum Zeit für handlungsorientiertes und genetisches Lernen, weil das Lernen von Erfahrung aus, durch Selbst entdecken und durch Suchen und Finden von Lösungswegen viel Zeit braucht.
Die Stoffüberlastung des Lehrplans, der seit den 60er Jahren durch die Bildungsreform noch beträchtlich angeschwollen ist, bildet ein Problem für die Verwirklichung handlungsorientierter Verfahren; er stellt jedoch kein unüberwindbares Hindernis dar. So bietet sich beispielsweise die Möglichkeit, den Lehrplan gemeinsam mit den Schülern durchzuarbeiten und so die Themenplanung von den Kindern mitbestimmen zu lassen. Hier muss man anmerken, dass dies auch ein spezifisch deutsches Problem ist, denn kaum ein Land hat so überfüllte Lehrpläne wie wir.
Es dürfte klar geworden sein, dass viele der grundlegenden Ideen und Forderungen der Reformpädagogik auch heute noch aktuell sind. Dennoch sollten die Schulkonzepte von damals nicht einfach unbesehen auf das heutige, teilweise doch stark gewandelte Schulwesen projiziert werden. Vielmehr sollten die Kerngedanken der damaligen Entwürfe herausgesucht, kritisch geprüft, mit den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen konfrontiert werden und erst dann in situationsangemessener Form auf die gegenwärtigen Schulen übertragen werden.
Es kann und darf nicht einfach heißen ‚Zurück zur Reformpädagogik’, auch weil sie mit viel pädagogischem Überschwang entstanden ist und dadurch teilweise von irrationaler Einseitigkeit gekennzeichnet ist, utopische Ansätze beinhaltet oder sich als ideologieanfällig erwiesen hat (vgl. Reble 1992, 32). Beispielsweise vertraten zahlreiche Reformpädagogen die Vorstellung, dass das Kind von einem unbewusst „richtigen“ Verhalten geleitet wird, wenn man es in seiner Entwicklung nicht stört. Sie gingen von dem von Natur aus gutem Menschen aus; Ziel der Erziehung war es lediglich, diesen zu erhalten und in seiner Entwicklung nicht zu stören (vgl. Scheibe 1978, S. 58 f.).
Dieser Denkweise kann jedoch heute nicht mehr zugestimmt werden, denn inzwischen ist erkannt worden, dass „geistiges Wachstum“ eben nicht ausschließlich von innen heraus erfolgt, sondern dass der Mensch sehr wohl erziehungsbedürftig ist und gefördert werden muss. Außerdem hat man eingesehen, dass Kindorientiertheit und Sachorientiertheit zusammengehören. Der Gefahr einer Überbetonung der Kindorientiertheit muss demnach bei der Beurteilung und Anwendung reformpädagogischer Konzepte Rechnung getragen werden (vgl. T. Dietrich 1992, S. 48).
Dennoch ist die Bedeutung der Reformpädagogik nicht zu unterschätzen. Reble (1992, S. 29) führt zunächst an, dass man nicht nur die Impulse der Reformpädagogik nutzen sollte, sondern auch die zahlreichen anderen, aktuelleren Versuche, Chancen und Beispiele für Unterrichts- und Schulreformen beachten sollte, die heute existieren bzw. sich entwickeln.
Er fügt jedoch hinzu: „Aber die Reformpädagogik birgt einen Riesenfundus von Anregungen pädagogischer, schulischer und Didaktisch-methodischer Art, die gründlicher zu durchleuchten, aufzunehmen bzw. zu variieren oder zu kombinieren sich lohnen könnte“ (Reble 1992, S. 29).
Ebenso warnt Potthoff (1994, S. 76) vor einer einseitigen Betonung der reformpädagogischen Verfahren, und fordert einen Ausgleich zwischen freiem und gebundenem Arbeiten. Wenn er auch der Ansicht ist, die Reformpädagogik müsste an die heutige Zeit angepasst und entsprechend abgewandelt werden, so ist er dennoch von ihrer Rechtfertigung und ihrem Erfolg überzeugt. „Wenn wir Gedanken der klassischen Reformpädagogik aufnehmen und mit neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen verbinden, meint das niemals, Altes und Bewährtes über Bord zu werfen, sondern Einseitigkeiten aufzugeben und mit der Fülle verschiedener Unterrichtsformen zugleich die Fülle des Lebens in die Schule zu holen und die Lernchancen unserer Schüler deutlich zu verbessern“ (Potthoff 1994, S. 76).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Reformpädagogik eine Fülle von guten Ideen, Methoden und Prinzipien hervorgebracht hat, die in vieler Hinsicht Anregungen und Vorbilder für die heutige Zeit liefern können. Die Rechtfertigung vieler reformpädagogischer Grundsätze ergibt sich geradezu aus den aktuellen Bedingungen, wie im folgenden Kapitel genauer dargelegt wird. Auf der anderen Seite unterscheidet sich jedoch die heutige Lebenswelt in verschiedenen Bedingungen und Vorraussetzungen so grundlegend von der damaligen, dass es nicht angehen kann, die Verfahren von damals unverändert und unreflektiert zu übernehmen. Die Reformpädagogik muss beispielsweise hinsichtlich verschiedener Aspekte ergänzt werden, die erst durch neuere Entwicklungen bedeutsam geworden sind. Hierzu zählen unter anderem die Verbreitung der elektronischen Medien, die eine vertiefte Medienpädagogik verlangen, die ökologischen Entwicklungen, deren Problematik zu einer frühzeitigen Umwelterziehung führen muss, oder auch die höhere Zahl der ausländischen Kinder, durch die die interkulturelle Pädagogik an Bedeutung gewinnt (vgl. Kap. 5: Aktuelle Begründungszusammenhänge).
In der Zwischenzeit sind zudem eine Reihe von alternativen Methoden und Verfahren entwickelt worden, die ebenfalls beachtet werden sollten (vgl. Winkler 1993, S.33 f.). Sinnvolle Konsequenz ist deshalb, sich als Lehrer einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten zu verschaffen und eine gewisse Handlungskompetenz der entsprechenden Methoden zu erlangen, um flexibel daraus auswählen und idealer Weise jeweils die beste Methode für ein bestimmtes Thema finden zu können, angepasst an die Klasse, die Situation der Schüler, die schulischen Rahmenbedingungen, etc.
Diese Offenheit findet sich teilweise auch bei Reichens Werkstattunterricht-Konzept: Dadurch, dass er es als nur einen Teil des Gesamtunterrichts einordnet, ermöglicht er den Einbezug anderer Unterrichtsformen. Darüber hinaus führen die verschiedenen Variationen von Werkstattunterricht zu einer weiteren Öffnung des Konzepts.
Allerdings stellt ein solches Auswählen aus der riesigen Methodenvielfalt sehr hohe Ansprüche, soll diese Freiheit nicht zu einem wahllosen Zusammenstückeln verschiedener Konzepte führen. Besonders am Anfang, bei den ersten Versuchen, den Unterricht zu öffnen, könnte sich deshalb gerade ein konkretes Konzept wie der Werkstattunterricht, dass sowohl geschlossene als auch offene Verfahren in ganz unterschiedlicher Gewichtung zulässt, als sehr hilfreich erweisen. Dabei muss allerdings auch beachtet werden, dass es sich um ein ganz besonderes Konstrukt handelt, das nicht auf jede Lehrerin und jeden Lehrer passen wird. Ebenso wie in der konstruktivistischen Didaktik kommt es hier vor allem auf eine Haltung an, die eingenommen werden muss, um effektiv mit dieser Methode zu arbeiten.
3.3 Aktuelle Begründungszusammenhänge
Nachdem deutlich wurde, dass Werkstattunterricht zahlreiche Parallelen zur Reformpädagogik aufweist, und auch die Aktualität dieser reformpädagogischen Forderungen aufgezeigt wurde, soll nun geklärt werden, wie sich das Konzept hinsichtlich der neueren Entwicklungen in der heutigen Zeit begründen lässt.
Es gibt verschiedene aktuelle Aspekte und Veränderungen, die eine Wandlung der Schule nötig machen. Im Folgenden sollen diese Entwicklungen, die sowohl im gesellschaftlichen als auch im ökonomischen Bereich liegen, zunächst näher beschrieben und schließlich ihre Auswirkungen auf die Schule dargestellt werden. Dabei soll vor allem auch betrachtet werden, inwiefern das Konzept des Werkstattunterrichts eine angepasste didaktische Möglichkeit im Bezug auf diese Veränderungen darstellt.
3.3.1 Kindheit im Wandel
Seit den 80er Jahren vollzieht sich in der Grundschule eine Bildungsreform, die hauptsächlich „von unten“, d.h. von den Lehrerinnen und Lehrern initiiert wird. Diese sehen Veränderungen der traditionellen Organisation und Gestaltung von Unterricht sowie des Selbstverständnisses der Grundschule als notwendig, da sie bei zahlreichen Kindern bedeutsame Veränderungen ihrer Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen und vor allem ihrer Verhaltensweisen beobachtet haben (vgl. Fölling-Albers 1998, S. 48).
Demnach hat sich insbesondere die Konzentrationsfähigkeit der Kinder verändert. Fähigkeiten, die als Voraussetzung für den Unterricht galten, wie zuhören, aufmerksam sein, stillsitzen und sich konzentrieren, bereiten vielen Kindern heute zunehmend Schwierigkeiten. Deswegen sind sie häufig nicht mehr in der Lage, dem traditionellen lehrerzentrierten, darbietenden Unterricht zu folgen. Viele Kinder wurden darüber hinaus als sehr unruhig, spracharm oder auch egozentrisch wahrgenommen. Hinzu kommen häufige durch eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten verursachte Schäden in der psychomotorischen Entwicklung.
Neben diesen problematischen Verhaltensweisen konnten jedoch auch positive Veränderungen ausgemacht werden, wie zum Beispiel eine besonders hohe Sensibilität, sprachliche Begabung oder auch Sachkompetenz einiger Kinder (vgl. Fölling-Albers 1998, 48ff.). Die veränderten Verhaltensweisen begründen sich in vielschichtigen gesellschaftlichen Entwicklungen, die seit den 70er Jahren das Aufwachsen der Kinder beeinflussen. Es hat ein rasanter gesellschaftlicher Wandel in den verschiedensten Bereichen stattgefunden, der einschneidende Veränderungen für das Aufwachsen der Kinder und dadurch auch für die Schule mit sich gebracht hat.
Von Preuss-Lausitz u.a. (1983) auch als „Modernisierungsschub“ bezeichnet, sind diese Wandlungsprozesse meist unter den Schlagwörtern „Veränderte Kindheit“ bzw. „Kindheit im Wandel“ bekannt. Im Folgenden sollen einige Aspekte dieses Wandels kurz dargestellt werden.
3.3.1.1 Vielschichtige Veränderungen
Wandel der Familienverhältnisse
„Kinder leben heute in veränderten sozialen Strukturen“ (Wallrabenstein 1991, S. 45): Neben der traditionellen Kernfamilie gibt es vielfältige familiäre Lebensformen, in denen die Kinder aufwachsen, beispielsweise Einelternfamilien, Scheidungsfamilien oder auch nichteheliche Lebensgemeinschaften.
Für viele Kinder bedeutet dies geringere soziale Erfahrungsmöglichkeiten, weil die Familien immer kleiner werden: Immer mehr Kinder wachsen heute mit nur einem Elternteil auf, meistens mit nur einem oder gar keinen Geschwistern, was auch darin begründet ist, dass die Geburtenrate stark zurückgegangen ist. Dies führt zu einer stärkeren Orientierung an den Erwachsenen und kann eine Vereinzelung der Kinder zur Folge haben, da sie so weniger soziale Erfahrungen mit anderen Kindern machen. Die Kinder müssen sich auf der einen Seite immer weniger die Zuwendung ihrer Eltern teilen, auf der anderen Seite wachsen sie jedoch auch immer einsamer auf. Jürgens (1994, S.28) führt aus, dass nach neuen Erkenntnissen heute bereits etwa 15 % der Grundschulkinder unter dem Fehlen verlässlicher Sozialbindungen leiden. Dies führt zu psychischen Störungen, die von autismusähnlichen Abkapselungen bis hin zu Aggressionen und Vandalismus reichen. Auch hier ist eine zunehmende Tendenz in den letzten Jahren zu verzeichnen.
Die Mehrheit der Mütter von Grundschulkindern ist heute erwerbstätig; die Zahl der Einelternfamilien steigt. Dies führt immer mehr zu einem Betreuungsproblem: Viele Kinder sind täglich vor und nach der Schule zumindest für einige Zeit auf sich gestellt oder es müssen Notlösungen gefunden werden.
'
Veränderungen im Erziehungsverhalten der Eltern
Es fand eine Liberalisierung der Erziehungsnormen und -werte statt. Waren noch in den 50er Jahren traditionelle „Erziehungstugenden“ wie Fleiß und Ordnungsliebe, Pünktlichkeit, Gehorsam oder Unterordnung wesentliche Ziele der Erziehung, so stehen bereits in den 70er Jahren ganz andere Aspekte, wie Selbständigkeit, Kritikfähigkeit, Kreativität und Kooperationsfähigkeit im Vordergrund (vgl. Fölling-Albers 1998, S.49). Die Eltern sind in ihrem Erziehungsverhalten liberaler geworden: autoritäre Erziehungsformen werden heute eher abgelehnt. Es wird weniger auf äußere Kontrollen und Strafen gesetzt und stattdessen mehr Einsichtsfähigkeit, Selbstkontrolle und eigene Verantwortung der Kinder gefordert.
Diese liberalen Erziehungswerte gelten jedoch nur in einem Teil unserer Gesellschaft. Daneben gibt es noch immer zahlreiche Fälle emotionaler und körperlicher Misshandlung von Kindern.
Eines der wichtigsten Merkmale der modernen und bewussten Erziehung ist die zunehmende Selbstständigkeit der Kinder, die ihnen nicht nur eingeräumt, sondern auch zugemutet und abverlangt wird. Auch das Verhältnis zwischen Kindern und ihren Eltern hat sich gewandelt: Die Bezüge sind gleichberechtigter geworden, Über- und Unterordnungsstrukturen spielen immer weniger eine direkte Rolle. Schlagworte wie „Von der Erziehung zur Beziehung“ oder „Von Befehlen und Gehorchen zum Verhandeln“ belegen dies (vgl. Jürgens 1994, S. 29).
Die Individualisierung und Liberalisierung hat jedoch auch negative Seiten. So sind die Schüler dadurch zunehmend gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen und erwarten, dass ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche unmittelbar befriedigt werden. Immer mehr Lehrer erleben ihre Schüler als sehr egozentrisch und wenig rücksichtsvoll. Demnach führt die fortschreitende Individualisierung anscheinend auch zu deutlichen Defiziten bei der Entwicklung der sozialen Einordnungsfähigkeit und der Gemeinschaftsfähigkeit (vgl. Jürgens 1994, S. 31).
Auf der anderen Seite stellen viele Eltern heute hohe Erwartungen an ihre Kinder, besonders was die Schulleistungen und den damit verbundenen Abschluss betrifft. Nach Rolff (1989) ist das Ziel von Kindererziehung immer weniger das zufriedene oder wohlgeratene Kind „sondern das leistungsfähige Kind“. So räumen die Eltern ihren Kindern zwar auf der einen Seite immer größere Spielräume bei der Lebensplanung ein, üben jedoch auf der anderen Seite häufig starken Druck auf die Kinder aus, was ihre Schullaufbahn betrifft.
Ein weiterer Aspekt, der bei dem veränderten Erziehungsverhalten der Eltern eine Rolle spielt, liegt in der Expertisierung der Erziehung. Diese gab den Eltern nicht nur eine Hilfestellung für ihre Erziehungsarbeit, sondern löste auf der anderen Seite auch eine Reihe von Ängsten und Unsicherheiten aus. Wie verunsichert sich Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder fühlen, belegt die Schwemme von Literatur, Fachzeitschriften, Ratgebern, usw. zu diesem Thema.
Dies hat bei Eltern immer öfter eine Erziehungsverweigerung zur Folge: sie geben die Probleme ab an die Kindergärten und Schulen und somit an Menschen, „die sich damit auskennen“.
Verinselte Kindheit
Bis zum Beginn der 60er Jahre eignete sich das Kind seine räumliche Umwelt mit zunehmendem Alter allmählich und ständig ausweitend an; die Ausdehnung seines Lebensraumes erfolgte selbsttätig in „konzentrischen Kreisen“.
Heute vollzieht sich die Aneignung dagegen nach dem ‚Modell des verinselten Lebensraumes: „Der Lebensraum ist nicht ein Segment der realen räumlichen Welt, sondern besteht aus einzelnen separaten Stücken, die wie Inseln verstreut in einem größer gewordenen Gesamtraum liegen, der als Ganzer unbekannt oder zumindest bedeutungslos ist“ (Zeiher 1983, S. 187).
Jürgens (1994, S. 33) weist auf ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang hin: Kinder werden zunehmend aus der Öffentlichkeit verdrängt, viele Straßen und Plätze sind unbespielbar geworden. Dadurch werden den Kindern lebensnotwendige Sozialräume entzogen.
Die Lebensräume der Kinder sind heute nicht mehr Straßen oder Hinterhöfe ihrer unmittelbaren Wohnumgebung, sondern eigens für sie eingerichtete Räume („Inseln“), wie z. B. Spielplätze oder Kinderzimmer. Den Kindern fehlen dadurch Spiel-, Aktions- und Freiräume, die sie unorganisiert und von Erwachsenen unbeobachtet auf eigene Faust nutzen und erkunden können.
Durch die Veränderung der Wohnumwelt hat zudem eine Verlagerung der ungebundenen Draußen-Aktivitäten zu zeitlich vorgegebenen Drinnen-Aktivitäten stattgefunden. Spontanes Spielen im Freien mit verschiedenen Kindern der Nachbarschaft findet immer weniger statt, da es aufgrund großer Verkehrsdichte, fehlender natürlicher Freiräume und oft auch aufgrund einer zu geringen Kinderdichte kaum noch möglich ist. Außerdem bleibt vielen Kindern durch eine ebenfalls „verinselte“ Freizeitgestaltung (s.u.) kaum noch Zeit zum freien Spielen mit anderen Kindern.
Der kindliche Lebensraum weitet sich heute bereits sehr früh aus auf die verschiedenen speziellen Institutionen und Angebote zur Betreuung oder Unterhaltung der Kinder. Viele Kinder nehmen an diversen Freizeitangeboten teil, die unabhängig voneinander an verschiedenen speziellen Orten stattfinden, wobei die Kinder meist zudem wegen der Entfernung und Verkehrsdichte auf den Transport von Erwachsenen angewiesen sind. Dies hat eine weitere Aufsplitterung des kindlichen Lebensraums zur Folge.
Insgesamt werden heute an die Kinder neue und höhere Anforderungen gestellt: Sie müssen sich selbst darum bemühen, innerhalb des verinselten Lebensraumes stabile soziale Beziehungen aufzubauen, sich in den wechselnden sozialen Zusammenhängen zurechtzufinden und zu versuchen, ihren zersplitterten Lebensraum als in sich geschlossenen, individuellen Erfahrungszusammenhang zu erleben. Dies ist eine grundlegende Voraussetzung für die Gewinnung von Ich-Identität.
Nicht alle Kinder verfügen jedoch über diese Qualifikationen, deshalb lässt sich, wie Hauck (1991, S.112) feststellt, die rapide Zunahme von Entwicklungsstörungen und psychischen Erkrankungen bei Kindern sicher zu einem Teil auf eine Überforderung durch eben diese komplexen Lebensbedingungen zurückführen.
Daneben eröffnet der verinselte Lebensraum dem Einzelnen aber auch ein höheres Maß an Freiheit; die im Zusammenhang damit entwickelten Fähigkeiten bilden die Voraussetzung für mehr individuelle Autonomie, die bereits Grundschulkinder zu nutzen wissen (vgl. Hauck 1991, S. 107 f.).
Verplante Zeit
Neben der räumlichen sind die Kinder heute auch von einer zeitlichen Verplanung betroffen. Dies kommt besonders in der zunehmenden Wahrnehmung von institutionalisierten Freizeitangeboten zum Ausdruck: Viele Kinder haben heute schon einen eben so vollen Terminkalender wie die Erwachsenen und werden bereits im frühen Alter auf die Einhaltung von Terminen getrimmt. Sie unternehmen auf diese Weise an wechselnden Orten in unterschiedlichen sozialen Gruppen ganz verschiedene Aktivitäten: beispielsweise im Malkurs, Turnverein, Flötenunterricht,... Dadurch machen Kinder zergliederte Raum- und Zeiterfahrungen und erleben ihr Spiel- und Freizeitverhalten oft als isoliert und unzusammenhängend (vgl. Jürgens 1994, S. 36).
Der Einfluss der Medien
Neben den bereits beschriebenen Veränderungen prägt die allgemeine Verbreitung und extensive Nutzung der elektronischen Medien, insbesondere des Fernsehens, die heutige Kindheit. Zahlreiche solcher Medien wie CD-Player, Fernseh- und Videogeräte, Game-Boys, Spiele-Computer oder PCs stehen den Kindern nahezu uneingeschränkt zur Verfügung. Kinder haben deshalb keine Ängste vor der Technik: Sie wachsen damit auf. Neben Computerspielen nimmt das Fernsehen den größten Teil der kindlichen Freizeitaktivitäten ein. Bereits 1993 verfügten 35% der 9-10jährigen über ein eigenes Fernsehgerät. Durch die Verkabelung ist die Dauer des Fernsehkonsums noch einmal drastisch angestiegen. Der Einfluss des Fernsehens wurde immer stärker, so dass heute bereits 70% einen eigenen Fernseher haben. In unserer Kultur verbringen wir bei 70 Lebensjahren durchschnittlich über 10 Jahre bereits vor der „Glotze“. Diese Bedeutung ist nicht zu unterschätzen und ist sicher die Ursache einiger tief greifender Veränderungen. Problematisch ist beispielsweise, dass das Fernsehen zunehmend aktivere Alternativen ersetzt. So wird es häufig von den Eltern als Babysitter eingesetzt; Video- oder Computerspiele dienen immer öfter als Ersatz für den Spielplatz.
Kindern ist es heute möglich, jederzeit auf Unterhaltung und Zeitvertreib durch die Medien zurückzugreifen. Dadurch kann auf Spielpartner verzichtet werden und es müssen keine eigenen Spielideen mehr gefunden werden.
Problematische Folgen hat hierbei die Möglichkeit, jederzeit aus einem Programm, das gerade nicht spannend ist, in ein anderes hinüber zu springen. Die Kinder somit daran gewohnt, in jeder Minute gut unterhalten zu sein.
Hauck (1991, S. 123) führt an, dass Untersuchungen über die Auswirkungen des Fernsehkonsums besonders bei Kindern vor allem auf die Unterschiede zwischen Realerfahrungen und den durch das Fernsehen ermöglichten Wahrnehmungs- und Aneignungstechniken hinweisen. Im Gegensatz zu realen Handlungs- und Kommunikationssituationen, die den Beteiligten normalerweise genügend Zeit und Raum geben, um sich auf eine Situation einzustellen und Gefühle und Gedanken dazu zu entwickeln, sind solche kognitiven und emotionalen Aktivitäten durch den raschen Wechsel der Bilder beim Fernsehen nicht mehr möglich. Laut Sturm (1985, S.53) kann dies im Extremfall bei der Entwicklung des Kindes zu Schädigungen im Gefühlsbereich führen.
Durch den Mediengebrauch wird die aktive Aneignung der Lebenswirklichkeit eingeschränkt: Kinder erfahren die Realität vermehrt indirekt, sie machen zunehmend weniger eigene Erfahrungen in der realen Welt und eignen sich die Wirklichkeit stattdessen über das Fernsehen an. Dies ist insofern problematisch, da sich hieraus ein Leben aus zweiter Hand ergibt: Das Fernsehen suggeriert zwar, die Wirklichkeit besonders realistisch wiederzugeben; hierbei handelt es sich jedoch um eine Täuschung. Im Fernsehen wird nicht die Wirklichkeit selber dargestellt, sondern eine Interpretation, eine bearbeitete Version der Realität (vgl. Hauck 1991, S. 117).
Ein besonders bedenklicher Aspekt in diesem Zusammenhang ist, dass es Kindern häufig schwer fällt, diesen Zusammenhang zu durchschauen. Wenn Kinder aber die Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und Fiktion nicht hinreichend und umfassend bewerkstelligen, kann dies schwerwiegende Folgen haben.
Jürgens (1994, S. 33) kritisiert weiterhin, dass die durch die Medien hervorgebrachte „Second-Hand-Wirklichkeit“ den Trend zum Aufenthalt in der Wohnung verstärkt und dadurch die Zeit für eigenständige Aktivitäten wie Spielen und Basteln einschränkt. Neben einem Rückgang der Selbsttätigkeit kann dies negative Folgen für kommunikative und soziale Kompetenzen der Kinder haben. Als weitere negative Folgen der vermehrten Mediennutzung führt er die Ausbildung einer dauerhaften Konsumhaltung und die Begünstigung einer überwiegend ikonischen Rezeptionsweise an.
Neil Postman vertritt die These, das Fernsehen führe zum „Verschwinden der Kindheit“ (Postman 1983). Im Unterschied zur Schriftkultur ist das Fernsehen eine ohne besondere Voraussetzungen nutzbare Informationsquelle. Den Ursprung der Kindheit sieht Postman jedoch darin, dass Erwachsensein und Kindheit entlang einer durch die Beherrschung bzw. Nichtbeherrschung der Schriftsprache markierten Grenzlinie als zwei völlig unterschiedliche Lebenswelten entstanden (vgl. Hauck 1991, S. 118). Da das Fernsehen den Zuschauern keine spezifischen Fähigkeiten abverlangt, hat die universelle Verbreitung des Fernsehens laut Postman (1983, S. 116) zur Folge: „dass es nicht mehr erforderlich ist, zwischen der Wahrnehmungsfähigkeit von Erwachsenen und der von Kindern zu differenzieren.“
Beinahe alle Versuche, die Auswirkungen des Fernsehkonsums besonders von Kindern zu beschreiben, kommen zu einer negativen Bewertung der Veränderungen durch die Massenmedien. Hauck (1991, S. 127) betont jedoch, dass es nicht richtig sei, die Auswirkungen des Fernsehkonsums nur abwertend zu sehen, da das Fernsehen neben den Nachteilen auch einige Vorteile mit sich bringt.
So hat das Fernsehen zum einen die Zugänglichkeit der Welt verändert, indem es eine großartige Ausweitung der menschlichen Wahrnehmungs- und fiktiven Erfahrungsmöglichkeiten brachte. Der leichte Zugang zu Medien aller Art schafft vorher nicht geahnte Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten, die auch eine Ausweitung des Erfahrungshorizontes und der Vorwissensbestände der Schüler ermöglicht.
Die Zurückdrängung von Realerfahrungen und die Einschränkung der Möglichkeiten zu direkter zwischenmenschlicher Kommunikation kann laut Postman (1983, S.163) Neugier und Staunen zum Verschwinden bringen. Hauck (1991, S. 128) hält jedoch dagegen, dass es sich hierbei um Grundbedürfnisse des Menschen handelt, die nur unterdrückt, aber nicht zerstört werden können. Er führt dem folgend weiter aus, dass bestimmte Wahrnehmungs- und Kommunikationsformen durch die Auswirkungen der Massenmedien nicht ausgelöscht, sondern verlagert werden und sich in kompensatorischen Aktivitäten und Bedürfnissen, wie einem gesteigerten Bedürfnis nach Beziehungen und authentischen Erfahrungen, ausdrücken. Diese zielen einzig auf die Überwindung der durch das Medium Fernsehen verursachten Einschränkungen im Erfahrungsleben seiner Benutzer ab. Hauck sieht auch hierin einen Vorteil des Fernsehkonsums. Diese Ansicht ist jedoch zweifelhaft, da dieses Kompensationsbedürfnis zwar negative Folgen verhindern mag, diese negativen Folgen ohne das Fernsehen aber gar nicht zur Debatte stehen würden.
Vielfalt der Kulturen
Eine weitere wichtige Veränderung liegt darin, dass die Kinder heute in einer Vielfalt von Kulturen aufwachsen. Der zunehmende interkulturelle Einfluss auf das alltägliche Leben jedes Einzelnen kann sowohl Gewinn und Bereicherung bedeuten, als auch Unsicherheiten und Ängste hervorrufen. Die heutigen Kinder müssen dadurch neue und höhere Sozialisationsleistungen in der Auseinandersetzung mit fremden Kulturen vollbringen: So lernen die Kinder schon im Kindergarten und in der Grundschule Wertvorstellungen aus sehr unterschiedlichen Kulturkreisen kennen, was hohe Anforderungen an das soziale Lernen stellt. Um eine Überforderung in diesem Zusammenhang zu verhindern, sollte man die Kinder mit diesen Anforderungen nicht allein lassen und ihnen frühzeitig haltgebende Orientierungshilfen geben, besonders wenn Kinder ausländerfeindliche Einstellungen von zu Hause mitbringen.
Eine wichtige Rolle spielt deshalb eine interkulturelle Erziehung, die versucht, den Dialog zwischen den Kulturen herbeizuführen, Ablehnung überwinden zu helfen und die Entwicklung von Verständnis, Toleranz und Akzeptanz des Fremden und Ungewohnten zu bewirken. „Nur so können Identität und Verhaltenssicherheit für alle Schülerinnen und Schüler gleichberechtigt entwickelt und Sinn- und Identitätskrisen durch kulturelle Entwurzelung und Abqualifizierung vermieden werden“ (Jürgens 1994, S. 38).
Diese Aufgabe wird umso bedeutsamer, je mehr das Problem der Vorbehalte und Gewalttaten gegenüber Ausländern zunimmt.
3.3.1.2 Die Konsequenzen der Schule aus dem Wandel der Kindheit
Auf die veränderten Bedingungen, unter denen Kinder heute aufwachsen, muss die Schule mit entsprechenden Konsequenzen reagieren. Durch die Veränderungen der Umgebung verändert sich auch das Kind: Es nimmt seine Umgebung unbewusst auf; sein Verhalten wird dadurch geprägt und diese Eindrücke und Verhaltensweisen bringt das Kind in die Schule mit. Ein guter Lehrer sollte deshalb die gesellschaftlichen Veränderungen kennen, um dadurch auch die Verhaltensweisen des Kindes besser verstehen und, wo nötig, Fehlentwicklungen auffangen zu können (Daub 1990, zitiert nach Behrning 1990).
So ist beispielsweise die zunehmend mangelnde Konzentrationsfähigkeit, die bei vielen Kindern beobachtet wurde (vgl. Fölling-Albers 1998, S. 48), sicher zu einem Teil auf die extensive Nutzung der Medien zurückzuführen: „Eine große Anzahl der Kinder verhält sich so, als sei ihr Zentralnervensystem an das Vorabendprogramm des Fernsehens angeschlossen: Ihr schulisches Verhalten ist ein Reflex auf schnelle Schnitte, Kliff-Hänger, Zapping usw.“ (Hensel 1995, S. 19).
Die Kinder sind es gewohnt, zu jedem Zeitpunkt gut unterhalten zu werden. In der Schule ist es ihnen jedoch nicht möglich, einfach in ein anderes Programm umzuschalten, wenn sie das dargebotene ‚Programm’ des Unterrichts langweilt. Diese Konsumhaltung sollte durch die Schule nicht noch weiter gefördert werden.
Auch Reichen (1991, S.11) weist darauf hin, dass man stattdessen mehr Wert darauf legen sollte, die Kinder zu möglichst viel Eigenaktivität herauszufordern und ihnen direkte Erfahrungen aus erster Hand zu ermöglichen. Dieses ist den elektronischen Medien nicht möglich; daher sieht er hier auch die einzige Chance der Schule, die Konkurrenz zu den Unterhaltungsmedien zu überwinden. Die Schule muss „die Konkurrenz mit den Medien dort suchen, wo sie unschlagbar ist: im Stiften von sozialen Prozessen und der Vermittlung von Erlebnissen und Erfahrungen aus erster Hand“ (Kretschmann 1988, zitiert in Reichen 1991, S.11).
Darüber hinaus ist es von großer Bedeutung, den Schülern einen verantwortlichen Umgang mit den Medien zu vermitteln. „Heute bleiben für viele Kinder wichtige Grunderfahrungen aus oder sind negativ geladen. Es ist aber ein gewaltiger Unterschied, ob die Kunde, die mitgeteilte Erfahrung, das Wissen aus zweiter Hand nur konsumiert oder mit eigenen Erfahrungen und einem eigenen Wertesystem verbunden werden kann, was dann auch eine selbständige Wertung, Selektion und Einordnung des vermittelten Wissens ermöglicht“ (Potthoff 1994, S. 72). Auch aus diesem Grund ist das Ermöglichen von Erfahrungen aus erster Hand so wichtig.
Auf der anderen Seite entwickeln einige Kinder durch die Nutzung der Medien als Informationsquelle eine sehr hohe Sachkompetenz. Diese sollte im Unterricht ebenfalls beachtet und genutzt werden. Im Werkstattunterricht wird dies beispielsweise dadurch berücksichtigt, dass die Schüler die Möglichkeit haben, zu einem selbst gewählten Thema einen Vortrag zu halten.
Eine weitere Folge der gesteigerten Nutzung der Medien ist der Rückgang an körperlicher Betätigung. Daneben führen auch die Veränderungen des kindlichen Lebensraumes zu eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten. Dadurch ist bei immer mehr Kindern eine gestörte psychomotorische Entwicklung zu beobachten (vgl. Jürgens 1994, S. 31).
Hieraus ergibt sich eine weitere neue Aufgabe der Schule: Sie muss den Kindern in diesem Bereich einen Ausgleich bieten und mehr Möglichkeiten für Bewegung und körperliche Betätigung schaffen.
Reichens Werkstattunterricht bietet verglichen mit dem traditionellen Frontalunterricht mehr Möglichkeiten für Bewegung im Klassenzimmer: Anstatt den ganzen Vormittag bewegungslos auf einem Stuhl sitzen zu müssen, dürfen die Kinder im Werkstattunterricht aufstehen und herumgehen; jedes Kind darf sich seinen Arbeitsplatz aussuchen; auch auf dem Fußboden darf gearbeitet werden. Einige Angebote der Werkstatt sollten auch aus dem Klassenzimmer herausführen; diese Forderung setzt bereits die Ermöglichung von Bewegung voraus. Der Aspekt der Bewegungsförderung ist demnach bereits in Ansätzen im Werkstattunterricht verwirklicht worden.
Diese Aufgabe der Schule wird vermutlich in der Zukunft noch bedeutsamer werden und sollte deshalb noch stärker beachtet werden als das bei Reichen der Fall ist. Zur Umsetzung der Forderung nach mehr Bewegung existieren bereits verschiedene gute Konzepte, die Reichens Werkstattunterricht positiv ergänzen könnten.
Ein Beispiel dafür ist das Konzept der „Bewegten Schule“, das beispielsweise in der Grundschule
Betzweiler-Wälde angewandt wird. Nähere Informationen: vgl. Homepage der Schule
http://web.archive.org/web/20010524103141/home.findall.de/gsbetzweiler/
Neben den bereits geschilderten Veränderungen werden die Aufgaben der heutigen Schule durch einen allgemeinen Wertewandel beeinflusst, wie er sich auch in dem veränderten Erziehungsverhalten der Eltern zeigt. Im Bildungsplan der Grundschule Baden-Württemberg (zitiert nach Behrning 1990) werden gefordert:
- „Entfaltung verborgener und nicht entwickelter Fähigkeiten
- Wecken einer sozialen, sittlichen, religiösen und freiheitlich demokratischen Gesinnung
- Erwerb gesicherter Kenntnisse und Einüben von Fertigkeiten, die für die Lebensbewältigung und für die Schularbeit grundlegend sind“.
Die Schule hat demnach heute vor allem zwei Aufgaben: Zum einen die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten, die schon immer als Auftrag der Schule angesehen wurde; zum andern soll sie aber heute vermehrt auch zur Erziehung der Persönlichkeit beitragen: der Erziehung zum freien, selbstbewussten, selbständigen und selbstverantwortlichem Menschen.
Die Schule sucht deshalb nach neuen Methoden, um diesen veränderten gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden zu können. Dabei ist es unabdingbar, auf individuelle Voraussetzungen der Kinder Rücksicht zu nehmen. Diese Voraussetzungen und Bedürfnisse der Kinder sind heute allerdings sehr verschieden und weichen immer mehr voneinander ab. Gerade in der Grundschule ist die Differenz der Vorerfahrungen und Leistungen oft riesig: es kommt vor, dass die Leistungen der Kinder einer Klasse drei verschiedenen Schuljahren entsprechen (Fölling-Albers 1998, S.45).
Das Lernen muss deshalb differenziert und individualisiert werden. Werkstattunterricht kommt diesen Forderungen in besonderem Maße nach: Die Kinder haben hier die Möglichkeit, „persönlichen Lerninteressen nachzugehen [...] [und] weitgehend selbst über Zeitpunkt, Tempo und Rhythmus der Arbeit, über deren Sozialform und über die Wahl von Lernangeboten [zu bestimmen]“ (Reichen 1991, S. 62).
Individualisierung, Differenzierung, sowie die Förderung von Selbständigkeit werden dadurch zu grundlegenden Bestandteilen des Unterrichts. Wenn man die individuellen Voraussetzungen betrachtet, die Kinder heute mit in die Schule bringen, so zählen hierzu insbesondere auch die interkulturellen Unterschiede. So trägt die Kulturenvielfalt zu der Bedeutung von Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts als Aufgabe der Schule bei. Abgesehen davon sollte Schule die Verschiedenartigkeit der Kinder positiv als Chance betrachten und vermehrt Unterrichtsmethoden anwenden, bei denen unterschiedliche Erfahrungshorizonte eine Bereicherung sind, und nicht einen Nachteil darstellen, wie es beim gleichschrittigen Frontalunterricht der Fall ist. Daneben liegt eine Aufgabe der Schule in diesem Zusammenhang auch darin, Toleranz und Verständnis der Kinder zu fördern.
In dieser Hinsicht spielt auch das soziale Lernen eine wichtige Rolle. Neben der Interkulturalität sind dabei die veränderten sozialen Bedingungen, in denen die Kinder heute aufwachsen, von Bedeutung. Daraus resultiert die Aufgabe der Schule, die sozialen Kompetenzen der Kinder vermehrt zu fördern. Sie soll dem zunehmenden Egozentrismus vieler Kinder entgegenwirken, mehr Rücksichtnahme und weitere Sozialkompetenzen wie die Entwicklung der Gemeinschaftsfähigkeit und sozialen Einordnungsfähigkeit fördern.
Im Werkstattunterricht spielt das soziale Lernen eine wichtige Rolle. Es wird durch verschiedene Komponenten des Konzepts unterstützt:
Einmal durch die freie Nutzung der verschiedenen Sozialformen*, die laut Reichen (1991, S.84) zu mehr Gesprächen und Zusammenarbeit führen und insgesamt ein friedlicheres Sozialklima in der Klasse bewirken. Auch die Sonderform des Helferunterrichts* begünstigt die Kooperation; daneben fördert das Prinzip der Kompetenzdelegation* das soziale Lernen in der Klasse.
Den Einfluss und die Bedeutung der Interkulturalität hat Reichen in seinen Ausführungen über den Werkstattunterricht nicht angesprochen. Durch die dargestellte Beachtung der sozialen Aspekte ist das Konzept dennoch geeignet, den Dialog zwischen den Kindern und die Integration der verschiedenen Nationalitäten und Kulturen zu fördern. Werkstattunterricht ermöglicht durch die angesprochenen Maßnahmen einen engen Kontakt der Kinder untereinander und bietet zahlreiche Gesprächsanlässe, bei denen die Kinder in einen Dialog treten können.
Die Schule soll das Kind so bilden und erziehen, dass es später den gesellschaftlichen und beruflichen Anforderungen genügen kann. Deshalb ist die Schule momentan in einem Wandel begriffen, der einerseits die Antwort auf die dargestellten gesellschaftlichen Veränderungen ist, andererseits aber auch aus Veränderungen in der Wirtschaft resultiert. Diese sollen im Folgenden genauer betrachtet werden.
3.3.2 Eine Kulturrevolution
Kahl (1993a) versucht, die Ursprünge dieser Veränderungen aufzuzeigen. 1986 ereigneten sich innerhalb kurzer Zeit mehrere Unglücksfälle der Industrie: wenige Monate nach der Katastrophe von Tschernobyl brannte in Basel eine Chemiefabrik.
Diese Unglücksfälle warnten plötzlich vor möglichen tödlichen Folgen der Industriegesellschaft und initiierten vor allem in Basel, wo Jürgen Reichen zu dieser Zeit tätig war, ein Umdenken: „Die Kultur der Schulen und Betriebe soll verändert werden. Es geht um den Schritt von der risikoreichen, scheinbar perfekt funktionierenden Industriegesellschaft zu einer nachindustriellen Gesellschaft“ (Kahl 1993a). Eine neue Moral der Zusammenarbeit in Schulen und Wirtschaft scheint erforderlich.
3.3.2.1 Umdenken und Wertewandel in der Wirtschaft
In zahlreichen Betrieben zeigt sich heute ein Prozess des Umdenkens: Man will weg vom alten Kommando- und Kontrollstil hin zu gerichteter Eigenständigkeit. Kreativität und Initiative der Mitarbeiter sollen gefördert werden (vgl. Kahl 1993a). Damit zusammen hängt auch eine Umwertung des Fehlers. Er wird neuerdings als Verbündeter der Lernenden entdeckt (vgl. Kahl 1995, S. 17). Man erkannte: „Nur das kann gelingen, was auch scheitern darf; was gelingen muss und nicht scheitern darf, geht irgendwann katastrophal schief“ (Kahl 1993a).
Laut Sembill (1992, S. 24) herrscht heute allgemein eine höhere Sensibilität sowie ein größeres Misstrauen gegenüber der Technik und dem verantwortungsvollen Umgang damit. Deshalb setzt man zunehmend anstelle des Maschinenperfektionismus auf die Menschen und ihre Fähigkeiten und Stärken. Bisher sollten Arbeiter in den Betrieben wie die Räder einer Maschine funktionieren, wobei die eigene Meinung lediglich Sand im Getriebe war. Statt der Persönlichkeit standen System und Organisation an erster Stelle. Dahinter verbirgt sich eine Denkweise, die kleine Fehler verbietet, die jedoch, wie man jetzt eingesehen hat, zu großen Fehlern führt.
Man hat nun auch zum Teil in der Wirtschaft erkannt, dass man, um auch in der Zukunft wettbewerbsfähig zu sein, nicht mehr auf Maschinen, sondern auf authentische, kreative Menschen bauen muss: „Humankapital“ wird zunehmend zum „Standortfaktor“ (vgl. Bildungskommission NRW 1995, S. 43). Die Mitarbeiter werden als Quelle für Ideen betrachtet; sie sollen experimentierfreudig und innovativ sein.
Reichen (1991, S. 35) führt in diesem Zusammenhang ein treffendes Zitat von Hügli (1988) an: „Wenn man vor ein paar Jahren noch Schulungsleiter der Industrie über die Aufgaben der schulischen Erziehung befragte, ergab sich folgendes Bild: [...] Gesucht war der brave, ordentliche Arbeiter, der fleißig tut, was man ihm sagt, ohne lang nach dem Warum und Wozu zu fragen. Wenn man Spitzenkräfte der Industrie heute reden hört, kehrt sich das Bild völlig um: Gesucht ist nun der urteilfähige, flexible, kreative, selbstbewusste, durchsetzungs- und teamfähige Mitarbeiter, der Prototyp des mündigen Bürgers [...]“.
Deshalb soll nun die Eigenständigkeit, Kreativität und Selbstverantwortung der Menschen gefördert werden. „Unternehmen, die im Wettbewerb überlegen sein wollen, können Menschen nicht mehr wie Aufziehpuppen behandeln. Sie brauchen deren Kreativität. Aber an die kommen sie nur, wenn sie die Mitarbeiter endlich als Persönlichkeiten anerkennen.“ (Kahl 1995, S.20). Die Menschen sollen nicht mehr nur willenlos „funktionieren“, sondern vielmehr ein höheres Verantwortungsbewusstsein sowie Problemlösefähigkeit entwickeln. Fehler werden deshalb in einem gewissen Maß zugelassen, da die Menschen lernen sollen, mit diesen umzugehen und auf neue Situationen und Probleme angemessen zu reagieren. So kritisiert Sembill (1992, S. 55) die bisher üblichen relativ einseitigen Lernprozesse und -Organisationsformen: Dabei werde „nur unzureichend berücksichtigt, wie ein Lernender in ihm unbekannten Problemzusammenhängen neues Wissen, das ihm ein theoriegeleitetes, begründetes Handeln ermöglicht, erzeugt“.
Daneben spielen Fehler auch im Hinblick auf die Kreativität eine wichtige Rolle. So bekräftigt der Bamberger Philosoph Walter Zimmerli (zitiert nach Kahl 1995, S. 19):
„Jeder kreative Schritt ist – vom Standpunkt des Bisherigen gesehen – ein logischer Fehler. Fehler müssen gewagt werden, wenn Neues entstehen soll -, auch wenn nicht jeder logische Fehler gleich kreativ ist“.
Diese veränderte Sicht führt darüber hinaus zu einer neuen Form von Lernen in der Ausbildung, die mit dem Schlagwort „Lernen statt Belehrung“ beschrieben werden kann. Die Lernenden sollen nun eigene Lösungswege finden anstatt wie bisher nur Vorgegebenes nachzumachen. Denn die Wirtschaft wird in Zukunft nur konkurrenzfähig sein, „wenn es ihr gelingt, die Anpassungsfähigkeit an veränderte ökonomische und technologische Bedingungen zu steigern“ (Bildungskommission NRW 1995, S. 42).
Damit zusammen hängt auch ein weiterer Aspekt: Das Wissen in der heutigen Zeit nimmt drastisch zu. Diese Wissensexplosion hat bedeutende Veränderungen in immer kürzeren zeitlichen Abständen zur Folge: Die Summe der Informationen, die heute verfügbar sind, verdoppelt sich – je nach Fachgebiet – alle drei bis zehn Jahre und veraltet zum Teil ebenso rasch. Das moderne Unternehmen wird deshalb „den Wandel zur Konstante machen müssen, um sich flexibel an ständig wechselnde Anforderungen anpassen zu können“ (Bildungskommission NRW 1995, S. 45). Dem entsprechend müssen die Menschen heute vor allem lernen, immer wieder dazu zu lernen und sich dabei auch von alten Dingen und Strukturen zu lösen. Sie sollten weniger aus Traditionen heraus handeln und sich ständig danach richten „wie etwas sein soll“, sondern vielmehr im direkten Dialog mit den konkreten Situationen handeln (vgl. Kahl 1993b). Zudem erfordern diese Veränderungen auf der einen Seite größeres Know-how; es werden Spezialisten mit hohem Fachwissen benötigt.
Auf der anderen Seite muss dieses Wissen aber auch zusammengefügt werden, wodurch eine Vernetzung innerhalb der Unternehmen notwendig wird. Um mit den Leistungen im internationalen Wettbewerb nach vorne zu kommen, ist deshalb eine andere Form von Arbeit und Kooperation nötig: die Organisation muss weniger asymmetrisch von oben nach unten erfolgen, sondern mehr vernetzt und symmetrisch: Die Mitarbeiter müssen kommunizieren; jeder muss sein Wissen und seine Fähigkeiten in die Zusammenarbeit einbringen (vgl. Haase, zitiert nach Kahl 1993b).
Neben dem Fachwissen sind also auch Sozialkompetenzen für die Kooperation von größter Bedeutung. Gerade hier liegen jedoch häufig große Defizite: die meisten Menschen sind nicht fähig, sich zu verbünden und eine gute Zusammenarbeit zu leisten, weil sie es gewohnt sind, als Einzelkämpfer möglichst viel eigenes Wissen anzuhäufen: Laut Kahl (1995, S. 19) prallen derzeit in den Unternehmen die neue Realitäten und die alte Struktur, die vorwiegend „Wissensegoisten und Einzelkämpfer, kommunikationsbehinderte Autisten, Rechthaber und Machthaber“ hervorbringt, aufeinander. Die Ausbildung der Sozialkompetenz in der Hochschule lässt bisher noch zu wünschen übrig.
Ein weiterer Grund für das Umdenken liegt in der Tatsache, dass durch den technischen Fortschritt der Großteil der anfallenden Routinearbeiten heute nicht mehr von Menschen sondern von Maschinen ausgeführt wird. Stattdessen entstehen zunehmend Arbeitsplätze mit höheren Qualifikationsanforderungen.
Die Forderungen, die sich daraus ergeben, tragen ebenfalls zum bereits angedeuteten Wertewandel bei: Es wird eine größere geistige Belastung, eine größere Übernahme von Verantwortung, mehr Fachkenntnisse, sowie eine verbesserte soziale und kommunikative Kompetenz verlangt (vgl. Sembill 1992, S. 22).
Reichen (1991, S. 35) nimmt auf diese Veränderungen ebenfalls Bezug: „Die Schule soll also heute jene Qualifikationen und Kompetenzen vermitteln, die morgen wesentlich werden. […]“ Für die Berufsqualifikationen bedeutet dies, dass in Zukunft Kreativität und Sozialkompetenz besonders relevant sind. In den anspruchsvolleren Berufsfeldern wird Kreativität der wesentliche Erfolgsfaktor werden, in den einfacheren (Dienstleistungs-) berufen wird hohe Sozialkompetenz von Vorteil sein“. Entsprechend richtet er sein Konzept in besonderem Maße auf die Förderung dieser Qualifikationen aus.
Kahl (1995, S. 18) weist zudem auf Veränderungen hin, die durch einen Wandel der Führungskultur und durch die Bemühungen, die Hierarchie in den Unternehmen abzuschaffen, vollzogen werden: „Nun werden Hierarchien von oben in Frage gestellt. Deren Abflachen wird vom Vorstand befohlen, nicht von unten erkämpft“ (Kahl 1995, S. 18). Folglich müssen sich Untergebene zu mündigen Mitarbeitern entwickeln.
Das entgegengebrachte Vertrauen und der gewährte Freiraum sollen sie zu mehr Risikobereitschaft ermuntern; sie sollen etwas wagen und Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten gewinnen. Legte man früher viel Wert auf die Kontrolle der Mitarbeiter, setzt man heute mehr auf Vertrauen; man geht davon aus, dass jeder Angestellte Positives leisten will. Es hat sich gezeigt, dass dieses Vertrauen sogar zu größeren Erfolgen führt (vgl. Kahl 1993a).
Die Qualifikationen, die neuerdings von den Mitarbeitern eines Unternehmens gestellt werden, liegen demnach mehr im Bereich von Selbst- und Sozialkompetenzen als von Sachkompetenzen wie bisher. Sie werden allgemein unter dem Begriff „Schlüsselqualifikationen*“ zusammengefasst. Und gerade hier liegen oft große Defizite. So klagen viele Unternehmen, „dass sie trotz hoher Arbeitslosigkeit nicht mehr in der Lage sind, ihre offenen Stellen zu besetzen, weil Schulabgänger nicht die erforderlichen Qualifikationen mitbrächten. Vor allem werden Defizite bei der Fähigkeit zur selbständigen Informationsbeschaffung, im Bereich der Kreativität, der Konfliktfähigkeit sowie bei der Fähigkeit zum vernetzten Denken beklagt“ (Struck & Würtl 1999, S. 25). Es ist demnach dringend erforderlich, dass die Schule in dieser Hinsicht neue Schwerpunkte setzt.
3.3.2.2 Die Konsequenzen der Schulen aus dem Wertewandel der Wirtschaft
Die beschriebenen Prozesse des Umdenkens in den Betrieben müssen sich, wie gesagt, auch auf die Schulen auswirken: Die Schule hat u.a. den Auftrag, auf das zukünftige Berufsleben vorzubereiten, weswegen sie auf die dort gestellten Forderungen eingehen muss. Dementsprechend spiegelt sich auch die bisherige Denkweise der Industrie, die lediglich funktionierende Arbeiter forderte, in der Schule wider: Die Wurzeln dieses Unterrichts liegen im 19. Jahrhundert. Es herrschte strenge Disziplin und es ging hauptsächlich darum, Regeln und Normen einzubläuen, wobei Lernen nur im Zusammenhang mit striktem Gehorsam erfolgte. Statt Individualität wurde Gleichförmigkeit gefördert: in militärischem Gleichschritt wurde der Wille der Kinder gebrochen, der als Eigensinn verdächtig war. Das Haupterziehungsziel der Schule war die Angepasstheit und Gefügigkeit, Tugenden wie Fleiß, Ordnungssinn, Gehorsam und Genauigkeit wurden gefordert; selbständiges Denken, Kreativität oder Kritikfähigkeit waren dagegen unerwünscht.
Auf diese Weise wurden die Menschen abhängig von Autoritäten und zu wohlerzogenen, leichten Bürgern für den Staat, sowie zu angenehmen, gefügigen Arbeitern (vgl. Kahl 1993b).
Auch heute noch ist der Frontalunterricht vielerorts gängige Schulpraxis. Meist fördert die Schule dadurch eine brave Buchhaltermentalität; Kreativität wird dagegen häufig vernachlässigt und die Phantasie behindert. Die Kinder müssen in der Regel viele Dinge lernen, die sie gar nicht interessieren, was zur Folge hat, dass die Neugierde nicht in der Schule aufgegriffen wird. Im üblichen frontalen Unterricht sind die Schüler oft nur äußerlich aufmerksam, während sie innerlich ganz woanders sind; das eigentliche Leben der Schüler spielt sich außerhalb der Schule ab.
Derzeit macht sich jedoch die Notwendigkeit eines Wandels der Schulen bemerkbar; hierbei wird die Industrie auch heute – allerdings nicht ganz uneigennützig – wieder zum Vorreiter für die Schule. Nun führt sie jedoch, entsprechend der neuen Denkweisen, zur Förderung ganz anderer Werte.
In einigen Schulen kündigen sich bereits tief greifende Veränderungen an. Ein Beispiel dafür ist laut Kahl (1993a) wieder Basel, wo seit dem Chemieunglück eine stille Revolution in den Schulen im Gange ist: Die Schule soll den Übergang von der lehrenden zur lernenden Gesellschaft unterstützen. Sie soll deshalb auch nicht mehr eine Anstalt der Belehrungen sein, sondern zur lernenden Institution werden. Dem entsprechend bemerkt Flitner sehr treffend: „Die Institution Schule ist für das Lernen der Kinder geschaffen; sie soll ihm dienen, sie soll ihm nicht ihre Eigengesetze aufnötigen“, und er fordert: „Die Schule [...] müsste sich selber nach den Bedürfnissen des Lernens laufend verändern, weil die Sozialbedingungen, die Lerngegenstände, die Erfordernisse und auch die Kinder in ständiger Veränderung begriffen sind“ (Flitner 1992, S. 231).
Angesichts der umgreifenden Veränderungen der Lebensbedingungen der Kinder sind Veränderungen der Schule deshalb unumgänglich: „Das bisherige Schulsystem hat sich in den Industriezeiten bewährt; jetzt geht es darum, ein Schulsystem zu entwickeln, das sich im nächsten Jahrhundert bewähren muss, welches kein Industriezeitalter mehr sein wird“ (Oswald, zitiert nach Kahl 1992).
Zum Erreichen der neuen Ziele ist ein Unterrichtsstilwandel nötig. Man setzt deshalb auch in der Schule nicht mehr länger allein auf frontale Belehrung, sondern fördert zunehmend das selbsttätige Lernen der Schüler: „Die Fähigkeit, sich Wissen anzueignen, [wird] stetig bedeutsamer [..], als über Wissen zu verfügen. Wir müssen mit einer zeitgemäßen Schule den Seiltanz hinbekommen, den Schülern ein Fundament an Grundwissen zu stellen und ihnen darüber hinaus die Kompetenz zu vermitteln, sich jeweils nötige Informationen selbst in Kürze zu beschaffen“ (Struck & Würtl 1999, S. 25).
Hensel (1995, S. 157 f.) warnt jedoch davor, die These vom rasch veraltenden Wissen zum Ausgangspunkt von Reformvorschlägen zu machen, da dadurch der gesellschaftliche Charakter von Schule verkannt wird. Dem entsprechend wird von der Bildungskommission NRW (1995, S. 81 f.) festgehalten: „Lernprozesse und die damit verbundenen individuellen und sozialen Erfahrungen gezielt zu ermöglichen, anzuregen, zu unterstützen und zu beurteilen, bleibt auch angesichts veränderter und erweiterter Aufgaben das Charakteristikum der Institution Schule in der Gesellschaft. Der gesellschaftliche Auftrag der Schule variiert, nicht aber die ihr eigene Grundleistung, nämlich der Zuerwerb von Wissen und Können“.
Hinzugefügt wird jedoch: „Das von der Kommission vertretene Verständnis von Lernen und Lernkultur setzt andere Schwerpunkte. Es zielt darauf, in den Lernzusammenhängen Identitätsfindung und soziale Erfahrung zu ermöglichen“ (Bildungskommission NRW 1995, S. 82).
Auf diesen neuen Zielsetzungen beruht auch das Prinzip des Werkstattunterrichts. Jürgen Reichen wurde zu einem Vorgänger der Basler Schulreform. Er sagt selbst, dass ganz am Anfang des Konzepts die Idee steht, Kinder zur Selbständigkeit zu führen, denn alles, was sie lernen, lernen sie selber oder gar nicht (vgl. Reichen, zitiert nach Kahl 1993a). Von daher steht das selbständige Lernen im Mittelpunkt seines Werkstattunterrichts.
Der Leselehrgang „Lesen durch Schreiben“, den Jürgen Reichen selbst entwickelte, baut ebenfalls auf diesen Ideen und Zielen auf: Selbsttätigkeit und Eigenständigkeit der Kinder stehen dabei - im Gegensatz zu den üblichen geführten Leselehrgängen - klar im Vordergrund (vgl. Kap. 7: Lesen durch Schreiben - Schriftspracherwerb im Werkstattunterricht).
Reichen (zitiert nach Kahl 1993a) fordert im Unterricht „Selbstverantwortung, Selbstregulierung, Selbstvertrauen und Selbständigkeit“. Dies wird in seinem Konzept deutlich. Die Erfahrung hat gezeigt, dass durch die Verwirklichung dieser Pogrammpunkte erstaunliche Erfolge erzielt werden können. Reichen geht sogar so weit, dass sich die Schüler in seinem Werkstattunterricht gegenseitig benoten: der jeweilige Chefeines Angebots* betreut dieses, beurteilt die Arbeiten der anderen Schüler, benotet diese und unterschreibt die Note schließlich. Reichen verzeichnet mit diesem „Management durch Vertrauen“ große Erfolge, mit denen er Befürchtungen, dass die Selbstorganisation dabei doch zu weit geht und unter den Schülern Notenschummelei betrieben werden könnte, abweist. Dennoch ist eine ernsthafte, gerechte und angemessene Notenvergabe von allen Schülern einer Klasse vermutlich nur bei einer bereits werkstatterfahrenen, sehr verantwortungsbewussten Klasse möglich.
Seine Aussage, die herkömmliche Misstrauenspädagogik sei verdummend und fördere in keiner Weise das Vertrauen der Kinder zu sich selbst und in ihre Fähigkeiten (vgl. Reichen, zitiert nach Kahl 1993a) ist auch im Hinblick auf die allgemeinen Lernkompetenzen der Schüler von Bedeutung: „Lernkompetenzen sind keine persönlichkeitsneutralen Fähigkeiten, sondern sie verlangen die Entwicklung von Ich-Stärke und Identität in Lernarrangements mit wachsender Eigenverantwortlichkeit der Schülerinnen und Schüler“ (Bildungskommission NRW 1995, S. 83). Da der Werkstattunterricht ein solches Lernarrangement darstellt, ist er auch in dieser Hinsicht gut geeignet.
Ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist laut Reichen das Verhältnis zum Fehler. Lange Zeit waren Fehler nicht erwünscht. Werden jedoch in einem Lernprozess Fehler vermieden, so kann dabei kein lebendiges Lernen zustande kommen; ebenso können dabei auch keine eigenen Wege gefunden werden (vgl. 5.2.1 Wertewandel in der Wirtschaft). Reichen sieht den Fehler dagegen als Verbündeten statt als Feind an, als ein notwendiges Durchgangsstadium in einem Prozess (vgl. Reichen, zitiert nach Kahl 1993a).
Die so bestehende Toleranz gegenüber Fehlern sollte man nicht etwa falsch verstehen als eine Aufforderung zum Falschmachen, sondern vielmehr als eine Ermunterung, eigene Wege zu gehen. Analog zu dem Wandel in der Wirtschaftskultur möchte man heute nicht mehr nur angepasste Schüler, die alles möglichst fehlerlos und perfekt machen, sondern selbstbewusste Kinder mit eigenen Impulsen und Meinungen.
Auch die Forderung nach einer besseren Förderung der Sozialkompetenzen wird im Werkstattunterricht erfüllt. Reichen hält das Lernen in einer Lerngemeinschaft für sehr wichtig: „Kinder lernen mehr und besser, wenn sie mit- und voneinander lernen“ (Reichen, zitiert nach Kahl 1993a). Aus dieser Erfahrung heraus entstand ein weiterer Kernpunkt seines Werkstattunterrichts: die Kompetenzdelegation*. Dadurch ermöglicht er den Schülern selbstständig, selbsttätig und selbstverantwortlich miteinander und voneinander zu lernen. Die Durchführung des Helferunterrichts*trägt ebenfalls dazu bei.
War der wichtigste Grundsatz der alten Schule das Konkurrenzprinzip, so will man dieses zwar heute als Wettbewerb erhalten, wobei jedoch gleichzeitig das Kooperationsprinzip zunehmend an Bedeutung gewinnt: Wie in der Wirtschaft wird auch in der Schule Solidarität gefordert und ein Miteinander statt der Einzelkämpfermentalität angestrebt. Dies wird durch das gemeinschaftliche Mit- und Voneinanderlernen als grundlegender Bestandteil des Werkstattunterrichts verwirklicht.
Die Forderung von Kooperationsbereitschaft und Teamfähigkeit statt des bisher üblichen Konkurrenzdenkens bedeutet besonders für Lehrer eine Umstellung. Sie sollten diese Kompetenzen nicht nur bei ihren Schülern fördern, sondern auch bei sich selbst. Die Zusammenarbeit von Lehrern, der Austausch von Ideen und Arbeitsmaterialien oder auch eine durchgängige und produktive Kommunikation untereinander sind noch lange nicht selbstverständlich. In einem Großteil der Schulen herrscht, ebenso wie in den Klassen, auch im Lehrerzimmer immer noch das Einzelkämpferprinzip, und viele Lehrer tun sich schwer damit, sich von dieser Denkweise zu lösen (vgl. Struck & Würtl 1999, 84 ff.).
Die Kinder müssen in der heutigen Zeit dazu fähig sein, sich in unübersichtlichen Zusammenhängen zu Recht zu finden. Sie müssen daher lernen, Schwierigkeiten zu lösen und unerwarteten Situationen zu begegnen. Entsprechend sollten sie auch beim Lernen eigene Wege finden und entdeckend und handelnd dazulernen, statt nur Vorgegebenes nachzuahmen.
In diesem Sinne kritisiert auch Reichen (1991, S. 16 f.) die hergebrachte Lernkultur: „Das landläufige Verständnis dessen, was unter schulischem Lernen zu verstehen sei, muss – wissenschaftlich gesehen – „naiv“ genannt werden. Es orientiert sich im Durchschnitt in unseren Volksschulen noch immer an einem undifferenzierten Nachahmungslernen durch Üben [...]. In Tat und Wahrheit „erarbeiten“ die Schüler hierbei aber fast nichts.“
Um die Kreativität, Eigenständigkeit und Selbstverantwortung der Schüler zu fördern, ist dagegen eine andere Art des Lernens notwendig. Reichen (1991, S. 17) folgert daraus: „Gefragt ist also ein Wechsel zu einem einsichtigen, selbstaktiven Lernen, zu einer Handlungs-Didaktik. Darin erscheint das Lernen als individualisierter, aktiver, konstruktiver, teilweise spielerischer Aneignungsprozess, selbstbestimmt und selbstkontrolliert.[...]Der zentrale Begriff der neuen Didaktik heißt „selbstgesteuert““. Diese Prinzipien legt er dem Konzept des Werkstattunterrichts zugrunde, wie auch seiner Erstlesemethode „Lesen durch Schreiben“.
Die Schule muss auf die in der Wirtschaft geforderten neuen Kompetenzen hinarbeiten, und eben diese Schlüsselqualifikationen fördern. Es wurde deutlich, dass im Werkstattunterricht sowie in der speziellen Anwendung „Lesen durch Schreiben“ viele der neuen Forderungen, wie zum Beispiel Selbständigkeit, Problemlösefähigkeit oder Sozialkompetenz bei weitem besser gefördert werden können, als dies im Frontalunterricht der Fall ist.
3.3.3 Zusammenfassung
Werkstattunterricht entspricht in vielerlei Hinsichten Forderungen, die heute an den Unterricht gestellt werden, in besonderem Maße. Das Konzept stellt in vielfacher Hinsicht eine Reaktion auf die umfassenden Veränderungen dar, sowohl im Bereich der veränderten Kindheit als auch bezüglich der neuen Forderungen im Bereich der Wirtschaft.
Einerseits wird ein Ausgleich zu möglichen Fehlentwicklungen durch den Einfluss der Medien oder auch die eingeschränkten Räume der Kinder angestrebt, indem Werkstattunterricht als ein Gegengewicht zur steigenden Passivität der Kinder wirken soll. So stehen die Eigenaktivität, Selbststeuerung und Selbstverantwortung im Zentrum des Unterrichts. Andererseits werden dadurch auch in hohem Maße die geforderten Schlüsselqualifikationen gefördert. Reichens Konzept des Werkstattunterrichts lässt sich deshalb aus den dargestellten aktuellen Begründungszusammenhängen heraus rechtfertigen und befürworten. Dabei ist allerdings kein Dogma intendiert, dass nun alle Lehrenden Werkstattunterricht betreiben müssen. Es ist eine Möglichkeit, die zu den Lehrenden und Lernenden passen muss. Und sie lässt sich zudem variantenreich weiter entwickeln und so – entsprechend unserem konstruktivistischen Grundverständnis – immer weiter und neu konstruieren.
|