7. Praxiserfahrungen
Es soll kurz dargestellt werden, ob das Werkstattunterrichtskonzept in der Praxis auch tatsächlich funktioniert, welche Probleme auftauchen oder ob es Punkte gibt, bei denen Forderungen der Theorie nicht in der Praxis zu verwirklichen sind. Des Weiteren sollen verschiedene Ausprägungen von Werkstattunterricht dargestellt werden. Reichen (1991, S.65) sagt selbst, dass jeder Lehrer seine eigenen Erfahrungen sammeln und auf diese Weise seinen eigenen Weg finden muss. Deshalb gibt es in der Praxis ein weites Spektrum verschiedener Varianten und Interpretationen von Werkstattunterricht.
Anhand von drei konkreten Beispielen, die auf Beobachtungen basieren, die im Jahr 1999 bei Hospitationen der Autorin in den genannten Schulen gemacht wurden, soll nun untersucht werden, wo Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen Anwendungen liegen, und was die betreffenden Lehrer und Lehrerinnen jeweils für Erfahrungen damit gemacht haben.
Darüber hinaus sollen die folgenden Berichte aus der Praxis eine lebendige Vorstellung des konkreten Unterrichtsalltags von Werkstattunterricht vermitteln.
7.1 Berichte aus der Praxis
7.1.1 Grundschule in Betzweiler-Wälde, 2. Klasse
Die Schule liegt mitten im Schwarzwald in einer ländlichen Gegend. Es handelt sich um eine sehr kleine Grundschule mit nur fünf Klassen. Das Lehrerkollegium besteht neben dem Rektor aus drei Lehrerinnen und einem Lehrer, die alle noch sehr jung sind, erst vor wenigen Jahren ihr Studium beendet haben und nun in dieser Schule verschiedene Formen des Offenen Unterrichts praktizieren.
Herr R. hat vorher schon Erfahrungen mit Wochenplanarbeit und Freiarbeit gesammelt. 1998 übernahm er erstmals eine erste Klasse. Er führte mit ihr Reichens Lehrgang „Lesen durch Schreiben“ durch und arbeitet nun auch weiterhin nach Reichens Werkstattprinzip. Der Werkstattunterricht nimmt bei ihm den weitaus größten Teil des Unterrichts ein. Er wird jedoch ab und zu durch Rituale wie den Morgenkreis ergänzt, sowie durch Bewegungsspiele in der Turnhalle, auch durch gelegentlichen Frontalunterricht, gemeinsames Kopfrechnen oder auch Projekte, durch Stunden, in denen die Schüler in Gruppen an Computern arbeiten oder auch eine Mathetheke.
Herr R. hat viele Elemente des Werkstattunterrichtkonzeptes übernommen. Er nennt seine Werkstatt jedoch „Lupe“. Eine „Lupe“ enthält immer mindestens 21 Angebote, da die Klasse aus 21 Schülern besteht. Jeder Schüler bekommt ein Angebot zugeteilt, für das er Chef ist und das er als erstes bearbeiten und vom Lehrer kontrollieren lassen muss. Diese Art des Chefsystems entspricht der von Reichen praktizierten.
Die Zuteilung von Angeboten bringt dem Lehrer den Vorteil, dass er bei jedem Schüler ein Angebot festlegen kann, das dieser auf jeden Fall bearbeitet. So kann er helfen, bestimmte Lücken aufzuarbeiten oder auch den Horizont des Schülers zu erweitern, da Schüler auf diese Weise teilweise auch Aufgaben bearbeiten, die sie selbst nicht gewählt hätten. Die „Lupe“ besteht aus einem Hängeregister, das vor der Tafel, für alle Schüler leicht zugänglich auf  einem Tisch steht. Die verschiedenen Arbeitsblätter und Aufträge sind dort in jeweils einem Hängeordner nach Nummern sortiert zu finden. An jedem solchen Ordner eines Angebots klebt ein Zettel mit dem Namen des zuständigen Chefs. einem Tisch steht. Die verschiedenen Arbeitsblätter und Aufträge sind dort in jeweils einem Hängeordner nach Nummern sortiert zu finden. An jedem solchen Ordner eines Angebots klebt ein Zettel mit dem Namen des zuständigen Chefs.
Eine „Lupe“ hat immer ein Oberthema, das meistens aus dem HuS-Bereich stammt; zu diesem Thema werden dann aus jedem Fach verschiedene Aufgaben gestellt.
Diese Angebote sind vielfältig: Sie bestehen je nach Schwerpunkt aus Arbeitsblättern, ermöglichen aber auch Experimente, freies Forschen, beinhalten Bastel- und Gestaltungsaufgaben ebenso wie Lese-, Schreib- und Rechenaufgaben. Da Herr R. den gesamten Unterricht bestreitet, kann er alle Fächer in eine „Lupe“ integrieren und aufeinander abstimmen, bzw. bestimmte Schwerpunkte setzen, ohne sich mit einem anderen Fachlehrer absprechen zu müssen.
Abbildung: Lupe
Für eine „Lupe“ stehen den Schülern jeweils zwei Wochen zur Verfügung. In dieser Zeit sollten sie versuchen, alle Angebote zu bewältigen, was mittlerweile auch fast alle Schüler schaffen. Eine Aufteilung in freie und obligatorische Angebote gibt es deshalb nicht.
Die Unterschiede zwischen den Schülern sind sehr groß und treten im Werkstattunterricht besonders deutlich hervor: Einige sehr gute Schüler erledigen die Aufgaben einer „Lupe“ innerhalb von vier Tagen, während andere Mühe haben, es bis zum Ende der zwei Wochen zu schaffen.
Für die guten Schüler hält Herr R. entsprechende Zusatzangebote bereit. Eine schöne Ergänzung bildet hierbei das Werk „Briefe von Felix“, das die Geschichte eines Stoffhasens, der verschiedene Städte bereist und von überall Briefe schreibt, erzählt. Im Zusammenhang mit dieser Geschichte werden verschiedene Aufgaben gestellt. Herr R. schätzt das Niveau des Materials als sehr anspruchsvoll ein. Einige der guten Schüler stürzen sich regelmäßig auf die freiwilligen „Felix“-Angebote, die immer parallel zur „Lupe“ bereitstehen.
Daneben stehen in Regalen verschiedene zusätzliche Angebote zur Verfügung, die sich die Schüler aussuchen können. Herr R. hat die Erfahrung gemacht, dass im traditionellen Unterricht oftmals die Gefahr einer Unterforderung besteht. So konnten zwei Schüler der Klasse schon lesen, als sie in die Schule kamen. Für diese ist das System des Werkstattunterrichts mit den anspruchsvollen Zusatzangeboten das ideale System.
Herr R. weist jedoch darauf hin, dass es im Werkstattunterricht dagegen leichter zu einer Überforderung einzelner Schüler kommen kann. Er selbst habe erst lernen müssen, das Niveau der Aufgaben richtig zu gestalten. Er sieht jedoch eine Lösung dieses Problems darin, auch leichtere Aufgabe zu stellen, sowie die Kinder keinem Zeitdruck zu unterstellen. Darüber hinaus sieht er die Möglichkeit der Differenzierung als einen großen Vorteil des Werkstattunterrichts: Im Werkstattunterricht hat der Lehrer die Möglichkeit, in Einzelbetreuung mit bestimmten Schülern einige Inhalte nachzuarbeiten, ohne dass es die anderen Schüler stört oder langweilt. Im traditionellen Unterricht werden solche schwachen Kinder meist irgendwie „mitgeschleift“, ohne dass sie viel vom Unterricht mitbekommen, weil sie schon lange den Anschluss verpasst haben.
Eine wichtige Rolle bei der Arbeit mit der Lupe spielen auch die Kontrollblätter* (vgl. Anhang), die in etwa den Arbeitskarten* entsprechen: Jedes Angebot der „Lupe“ ist in einem Kästchen eingetragen. Bereits erledigte Angebote sind durch die Unterschrift des zuständigen Chefs gekennzeichnet. Auf diese Weise erhalten die Kinder selbst einen Überblick darüber, was sie bereits geschafft haben. Auf dem Kontrollblatt stehen auch die Hausaufgaben für die zwei Wochen der „Lupe“.
Wie Herr R. berichtet, wissen die Schüler genau, dass sie pro Tag etwa drei Angebote der „Lupe“ und eine Hausaufgabe erledigen sollten, um mit der Zeit hinzukommen. Wenn sie in der Schule zu wenig geschafft haben, aus welchem Grund auch immer, arbeiten sie das zu Hause nach. Hier sieht er einen weiteren bedeutsamen Vorteil des Werkstattunterrichts: Die Schüler lernen, Selbstverantwortung für ihre Arbeit und ihren gesamten Arbeitsprozess zu übernehmen. Auf diese Förderung von Selbständigkeit und einer guten Arbeitsmoral kommt es Herrn R. an.
In diesem Sinne konzipiert er auch die Arbeitsblätter für die Lupe. Sein Anspruch ist, dass die Blätter ansprechend und klar gestaltet sind. In dieser Hinsicht kritisiert er auch die von Reichen konzipierten Arbeitsblätter, die er nur kurze Zeit am Anfang verwendet hat, bevor er dazu überging, nur noch selbst entwickelte Aufgaben zu verwenden.
Herr R. legt keinen Wert darauf, dass die Arbeitblätter besonders verziert sind. Im Gegenteil; ihm ist wichtig, dass die Kinder lernen: „Lernen ist Arbeit!“. Einigen Kindern kommt dies entgegen: sie wollen arbeiten und lernen und übernehmen deshalb auch gerne Selbstverantwortung für ihre Arbeit. Anderen dagegen bereitet es große Probleme. Dazu zählen vor allem solche Kinder, die das selbständige Arbeiten nicht gewohnt sind, weil sie zu Hause alles vorgesetzt bekommen. So sind einige Schüler am zufriedensten, wenn ihnen genau gesagt wird, was sie wann zu tun haben.
Herr R. gibt zu, dass er dies ab und zu auch tut, weil er überzeugt ist, dass diese Kinder sonst nie alleine lernen würden, sich ihre Arbeit einzuteilen. Er stellt auch die Vermutung an, dass selbstverantwortliches Arbeiten teilweise ein Problem der Veranlagung ist. Er glaubt, dass die Kinder, denen es extrem schwer fällt, auch später im Beruf noch Schwierigkeiten damit haben werden. Deshalb hält er die Förderung von selbstverantwortlichem Arbeiten bereits in der Grundschule für sehr wichtig.
Das Klassenzimmer ist wie von Reichen (1991, S.71) empfohlen in verschiedene Zonen aufgeteilt, die durch Regale voneinander abgetrennt werden: Es gibt eine Matheecke, eine Spielecke, eine Bau- und Experimentierecke, einen Lesesessel und eine Computerecke. Daneben hat jedes Kind seinen Platz an einem der zwei großen Gruppentische im Raum. Eine feste Sitzordnung gibt es hierbei jedoch nicht, jedes Kind kann jeden Morgen seinen Sitzplatz frei wählen. Meinungsverschiedenheiten in diesem Zusammenhang regeln die Kinder untereinander, wobei es selten zu solchen kommt.
Die Atmosphäre im Klassenzimmer ist sehr wohnlich und angenehm: Das Prinzip „Schule als Lebensraum“ (vgl. Bildungskommission NRW 1995, S. 75) wird hier fühlbar: Schüler und Lehrer tragen bequeme Hausschuhe, ein Wasserkocher wird von Zeit zu Zeit genutzt, um Tee zu kochen, und in einer Ecke steht ein alter gemütlicher Sessel, der zum Lesen einlädt.
In einer anderen Ecke sind zwei Computer aufgestellt. In der Regel enthält jede „Lupe“ mindestens ein Angebot, das am Computer bearbeitet werden muss. Meist handelt es sich hierbei um die Aufgabe, in Partnerarbeit eine Geschichte zu einem vorgegebenen Thema zu schreiben. Daneben können an den Computern in der freien Zeit vor Unterrichtbeginn oder auch zwischendurch, in Absprache mit dem Computerchef, verschiedene Lernspiele gespielt werden.
Der Ablauf des Unterrichts stimmt mit dem von Reichen beschriebenen größtenteils überein: Die Schüler können sich, nachdem sie das zugeteilte Chef-Angebot erledigt haben, bei der „Lupe“ ein Angebot aussuchen. Wie Herr R. berichtet, nehmen sich einige Kinder viel Zeit dafür und treffen schließlich eine bewusste Entscheidung.
Abbildung: Hannes wählt ein Angebot der Lupe aus
 Wenn sich ein Schüler für eine Aufgabe entschieden hat, liest er den Namen des zuständigen Chefs ab, geht zu ihm und lässt sich erklären, was zu tun ist. Wenn sich ein Schüler für eine Aufgabe entschieden hat, liest er den Namen des zuständigen Chefs ab, geht zu ihm und lässt sich erklären, was zu tun ist.
Manche Kinder lesen den Auftrag auch selbst, was zwar von größerer Eigenständigkeit zeugt, jedoch auch zu Problemen und Streit führt, wenn sie den Arbeitsauftrag falsch verstanden haben und deshalb später vom Chef zurechtgewiesen werden. Herr R. ist sich dieser Probleme bewusst, greift dabei jedoch niemals ein, da hierbei Kritikfähigkeit von den Kindern gefordert wird, die auch gelernt werden muss.
Die Kinder bearbeiten die Aufgaben recht selbstständig; wenn sie Fragen haben, gehen sie zu dem zuständigen Chef, der ihnen hilft, ihre Aufgaben am Ende auch korrigiert und ihnen bei zufrieden stellendem Ergebnis das entsprechende Feld auf ihrem Arbeitszettel unterschreibt.
Das Chefsystem bietet zwar viele Vorteile, in der Praxis wird jedoch auch ein Nachteil deutlich: Steffen ist gerade in die Lösung eines mathematischen Problems seines Arbeitsblattes vertieft; er versucht, die Lösung einer schwierigen mehrschrittigen Aufgabe im Kopf auszurechnen, als Marie zu ihm kommt und nachfragt, was bei der Aufgabe, für die er Chef ist, zu tun ist. Steffen ist sichtlich verärgert, da er dadurch aus seiner Rechnung herausgerissen wurde, nun den Faden verloren hat und später seine Denkarbeit von vorne beginnen muss. Er darf sich allerdings nicht beschweren: Marie ist im Recht, da es Steffens Pflicht ist, als Chef des Angebots für Fragen zur Verfügung zu stehen. Er erklärt deshalb Marie, wie die Aufgabe, übrigens eine Aufgabe aus dem Bereich Deutsch, zu bearbeiten ist. Anschließend wendet er sich wieder seiner Matheaufgabe zu. Er scheint gerade den Faden wiedergefunden zu haben, und will eben beginnen, in seiner Arbeit fortzufahren, als er wiederum gestört wird. Diesmal ist es Erik, der möchte, dass Steffen sein Ergebnis der Aufgabe, für die er zuständig ist, kontrolliert. In der Regel passiert nun folgendes: Steffen, in Gedanken noch ganz bei der Matheaufgabe und bemüht, nicht wieder den Faden zu verlieren, wirft nur einen kurzen Blick auf Eriks Blatt und unterschreibt schnell auf dessen Kontrollblatt, um dann endlich mit seiner eigenen Arbeit fortfahren zu können.
Diese Beobachtung ist kein Einzelfall, sondern wiederholt sich in ähnlicher Weise ständig. Es werden dabei gleich zwei Probleme des Chefsystems deutlich: Durch den Chefposten werden die Schüler immer wieder in ihrer Arbeit gestört; wirkliche längere Konzentration und Vertiefung in eine Sache wird durch die vielen Unterbrechungen erschwert. Besonders bei schwierigen oder beliebten Aufgaben wird der zuständige Chef andauernd durch Fragen, Kontrollpflichten u. ä. abgelenkt und bei seiner Arbeit gestört.
Daraus resultiert ein weiteres Problem. Wird der Chef zu einem ungünstigen Zeitpunkt in seiner Arbeit gestört, so erfüllt er seine Aufgabe des Kontrollierens der Aufgaben nur unzureichend. Immer wieder gibt es Fälle, bei denen ein völlig fehlerhaftes Arbeitsblatt vom Chef angenommen und abgezeichnet wird, nur weil der Chef gerade keine Zeit oder auch einfach keine Lust hat, das Ergebnis gewissenhaft zu kontrollieren und deshalb seine Unterschrift bereitwillig gibt, ohne wirklich zu kontrollieren. Der Lehrer muss sich dieses Sachverhalts bewusst sein und entsprechende Ausgleichsregelungen finden.
Dennoch sieht auch Herr R. im Chefsystem einen Hauptvorteil des Werkstattunterrichts, da die Kinder dadurch einerseits zu Eigenständigkeit und Selbstverantwortung erzogen werden, andererseits im ständigen Austausch untereinander Konfliktfähigkeiten und weitere Sozialkompetenzen gefördert werden.
Das Problem der mangelhaften Kontrolle fängt Herr R. teilweise durch eigene Nachkontrollen auf: Er kontrolliert und korrigiert sowohl die Hausaufgaben als auch jede abgeschlossene „Lupe“. Seinen Berichten zufolge verringert sich der hohe Aufwand an Nachbereitung jedoch mit der Zeit, da man bald weiß, bei wem man die Ergebnisse überfliegen kann und bei wem man genauer nachschauen muss.
Herr R. betont dennoch, dass Werkstattunterricht einiges mehr an Aufwand, Einsatz und Engagement des Lehrers verlangt. Dies betrifft zum einen die Vor- und Nachbereitung; zum anderen aber auch die Beanspruchung des Lehrers im Unterricht. Für die Vorbereitung einer Werkstatt braucht Herr R. mittlerweile etwa 8 Stunden Zeit. Darüber hinaus ist auch der Unterricht sehr anstrengend für den Lehrer, da er pausenlos im Einsatz ist. Jeder braucht und beansprucht ihn, vor allem natürlich die schwachen Schüler; doch auch die guten verlangen Zuwendung, Lob und Anerkennung.
Reichen (1991, S.85) betont, dass ein guter Überblick, sowie eine durchgängige Beobachtung der Schüler von großer Bedeutung ist. Herr R. hat sich zu diesem Zweck eine Kartei angelegt, in die er die Beobachtungen der einzelnen Kinder regelmäßig einträgt. Auch diese Aufgabe fordert einen ständigen Einsatz des Lehrers.
Bei der Rechtfertigung der Unterrichtsform vor den Eltern gab es keine Schwierigkeiten, wie Herr R. berichtete. Er hat vor Unterrichtsbeginn einen umfassenden Informationsabend abgehalten, und dort den Film von Reinhardt Kahl „Das Lob des Fehlers – Ein Coach und 23 Spieler“ gezeigt, der sehr überzeugend gewirkt hat.
Die Kinder sind zu einem großen Teil mit dieser Art von Unterricht zufrieden, wobei auch zu bedenken ist, dass sie nicht wirklich vergleichen können, weil sie niemals „normalen“ Frontalunterricht erfahren haben, sondern von Anfang an in dieser Weise unterrichtet wurden.
Die meisten Kinder finden es gut, dass man sich selbst aussuchen kann, was man wann macht.
Bei der Auswahl der Angebote verfolgen sie verschiedene Taktiken: Vanessa und Jasmin z.B. geben an, dass sie meist etwas Leichtes am Anfang machen, um erst mal „warm zu werden“, Stefanie erzählt, dass sie sich schwere Aufgaben oder Aufgaben am Computer in der Regel mit nach Hause nimmt, weil sie dort mehr Ruhe hat und ihr ein besserer Computer zur Verfügung steht; Julia berichtet, dass sie zu Beginn einer „Lupe“ sehr schnell und intensiv arbeitet, um sich später Zeit lassen zu können. Dominik und Andreas geben an, die Aufgaben zum Diktat als erstes zu erledigen, um dann noch mehr Zeit zum Üben zu haben.
Daneben gibt es jedoch auch Kinder, die bei der Auswahl kein bestimmtes Schema verfolgen, sondern sich spontan für ein Angebot entscheiden. Häufig weckt ein bestimmtes Angebot auch Interesse, wenn es vom Nachbarn oder Freund eines Kindes bearbeitet wird.
Herr R. sieht die Durchführung des Werkstattunterrichts als einen Selbstversuch an, da er diese Form von Unterricht zum ersten Mal praktiziert und selbst gespannt ist, wie die Kinder aus der Grundschule gehen und ob dabei besondere Veränderungen auffallen, nachdem sie diesen Unterricht erfahren haben.
Insgesamt bewertet Herr R. diese Form von Unterricht bisher sehr positiv. Besonders sein Hauptanliegen, dass die Kinder Selbstverantwortung für ihre Arbeit übernehmen, wird im Werkstattunterricht optimal gefördert.
7.1.2 Grundschule in St. Ilgen, 3. Klasse
An die Grundschule in St. Ilgen ist ein neues Wohngebiet angeschlossen, in dem zum Großteil zugezogene Aussiedler wohnen. Dadurch ist die Schule in kurzer Zeit stark gewachsen. In der Klasse sind Kinder vieler verschiedener Nationen und Kulturen. Die meisten von ihnen haben sich jedoch sehr angepasst, in den Familien wird nur noch wenig die ursprüngliche Kultur gepflegt, was von der Lehrerin sehr bedauert wird.
Die Lehrerin, Frau B. hat nach ihrem Studium zunächst einige Jahre „normalen“ Frontalunterricht praktiziert. Als sie 1997 wieder eine erste Klasse übernahm, entschied sie sich, mit dieser Klasse „Lesen durch Schreiben“ durchzuführen. Hierbei machte sie sehr gute Erfahrungen sowohl mit dem Lehrgang „Lesen durch Schreiben“ als auch mit der Form des Werkstattunterrichts. Nach zwei Jahren musste sie die Klasse jedoch abgeben, und übernahm eine dritte Klasse, die bisher rein frontal unterrichtet worden war.
Auch in dieser Klasse hat sie nun die Unterrichtsform Werkstattunterricht eingeführt. Da es außer ihr an der Schule kaum Lehrer gibt, die sich bemühen, ihren Unterricht zu öffnen, stößt sie damit teilweise auf Ablehnung. Dies führt zu einigen Problemen, da ihr nicht der gesamte Unterricht unterliegt, sondern verschiedene Fachlehrer, beispielsweise in Mathematik, in der Klasse unterrichten.
Das Klassenzimmer ist deshalb auch nicht in verschiedene Lernzonen aufgeteilt. Wie im ersten Beispiel haben die Schüler aber auch hier die Möglichkeit, täglich selbst über die Sitzordnung zu entscheiden.
Eine Werkstatt umfasst bei Frau B. jeweils 10 bis 11 Angebote, die einzeln auf fest eingerichteten Plätzen in Kästen auf Tischen am Rand des Klassenzimmers bereit liegen. Jeweils daneben ist eine Karteikarte mit der Arbeitsanweisung für die entsprechende Aufgabe auf den Tisch geklebt. Als Oberthema der Werkstatt dienen Frau B. nicht nur Themen aus der Sachkunde, sondern auch Bereiche des Faches Deutsch. Besonders gut eignen sich nach ihrer Erfahrung Themen, bei denen viel experimentiert werden kann, wie beispielsweise die Themen „Wasser“ oder „Luft“.
Die Angebote sind aufgeteilt in obligatorische und freie Aufgaben, wobei die obligatorischen den weitaus größten Teil ausmachen; meistens sind nur zwei von den elf Aufgaben frei. Dies widerspricht Reichens Hinweis, die obligatorischen Angebote möglichst sparsam einzusetzen (vgl. Reichen1991, S. 68).
Auch ein Computer steht der Klasse zur Verfügung, an dem verschiedene Lernprogramme durchgeführt werden können. Er kann innerhalb der Werkstatt jederzeit frei genutzt werden, ist jedoch nicht immer mit einem konkreten Angebot der Werkstatt verbunden. Das Schreiben von Geschichten am Computer wird dagegen weniger praktiziert.
Werkstattunterricht nimmt in dieser Klasse einen weitaus geringeren Anteil des Gesamtunterrichts ein, als es bei Herrn R. der Fall war: Den Schülern steht täglich eine Stunde für die Arbeit in der Werkstatt zur Verfügung, während der Rest des Unterrichts größtenteils frontal abläuft. Den Schülern wird eine Gesamtzeit vorgegeben, die ihnen für die Bearbeitung der Werkstatt zur Verfügung steht; meistens eine oder zwei Wochen, bei jeweils einer Stunde am Tag. Wer es schafft, in dieser Zeit alle Angebote zu bearbeiten, bekommt als Belohnung zwei Süßigkeiten, wer alle obligatorischen Aufgaben gelöst hat, erhält eine Süßigkeit.
Dieses Verfahren findet bei den Kindern großen Zuspruch und scheint sehr motivierend zu wirken. Daneben wird jede Werkstatt benotet. Wenn also einige Kinder ihre Zeit nicht nutzen und nur wenige Angebote der Werkstatt bearbeiten, erhalten sie dementsprechend eine schlechte Note. Umgekehrt können sich die Schüler durch Fleiß eine gute Note erarbeiten.
Es ist jedoch fraglich, ob diese Formen von Motivation* allgemein ratsam sind, da es sich hierbei um Formen von stark sekundärer Motivation handelt, denen primäre Motivation klar vorzuziehen wäre. Auch Reichen (1991, S. 21) weist darauf hin, dass es motivationspsychologisch gesehen viel wichtiger ist, dass sich ein Schüler „der Sache wegen“ mit einem Lernstoff auseinandersetzt, da Lernen „um der Sache“ willen den nachhaltigeren Lernerfolg hat als Lernen aus sachfremden Gründen: „Auf Dauer gesehen kommt darum jener Schüler, der sich aus Interesse mit dem Lerngegenstand beschäftigt, weiter als sein Kamerad, der sich nur anstrengt, weil ihm daran liegt, von der Lehrerin [...] belohnt zu werden“ (Reichen 1991, S.21).
Auch das Chefsystem ist Bestandteil des Werkstattunterrichts in dieser Klasse; es wird hier jedoch in einer etwas anderen Form angewendet, als in der von Reichen praktizierten. Zu Beginn einer neuen Werkstatt kann sich jedes Kind selbst ein Angebot aussuchen. Chefs werden nicht festgelegt. Die ersten zwei Schüler, die ein Angebot bearbeitet haben, lassen das Ergebnis von der Lehrerin kontrollieren und dürfen dann selbst entscheiden, ob sie Chef dieses Angebots sein wollen. In diesem Fall werden die Namen zu dem Angebot geschrieben, damit alle Schüler, die das Angebot anschließend bearbeiten, wissen, an wen sie sich wenden sollen.
Auf diese Weise übernehmen nicht alle Schüler Verantwortung, was eigentlich Ziel des Chefsystems ist. Auf der anderen Seite bietet dieses Verfahren jedoch verschiedene Vorteile; es überwindet insbesondere die oben angesprochenen Probleme: Die Schüler treffen die Entscheidung, ob sie Chef sein wollen oder nicht sehr bewusst. Einigen Schülern bereitet es große Probleme, wenn sie immer wieder in ihrer Arbeit gestört werden, anderen macht das gar nichts aus. Daneben ist es von Vorteil, dass jeweils zwei Schüler für ein Angebot zuständig sind. Hat nun ein Schüler eine Frage, so kann er zu demjenigen Chef gehen, der gerade weniger beschäftigt ist; dadurch muss jeder Chef insgesamt nur noch die Hälfte der Fragen annehmen.
Wie die Erfahrung gezeigt hat, erfolgt die Kontrolle durch die Schüler dennoch recht flüchtig, deshalb korrigiert die Lehrerin die Arbeiten teils stichprobenhaft, teils auch durchgängig nach.
Da die Klasse vorher rein frontal unterrichtet worden war, waren die Schüler zu Beginn des Schuljahres noch sehr unselbstständig, und die Umstellung durch die Einführung des Werkstattunterrichts war für die Lehrerin sehr anstrengend.
Mit der Zeit gelangten die Schüler jedoch zu mehr Selbstständigkeit, wodurch auch die Durchführung des Werkstattunterrichts immer reibungsloser verläuft. Genau hier liegt auch das Hauptanliegen der Lehrerin: Die Erziehung zur Selbstständigkeit steht bei ihr an erster Stelle. Werkstattunterricht ist ihrer Meinung nach und aus ihren Erfahrungen heraus die optimale Unterrichtsform dafür.
Auch nur eine Stunde Werkstattunterricht am Tag wirkt sich bereits entscheidend auf das gesamte Verhalten der Schüler aus, und man kann auch im übrigen Unterricht anders mit ihnen arbeiten. Darüber hinaus sieht Frau B. im Werkstattunterricht insbesondere eine Unterrichtsform, die den Kindern gerecht wird. Sie berichtet, dass sie in den Jahren, als sie noch frontal unterrichtete, oftmals das Gefühl hatte, die Schüler nicht ernst zu nehmen.
Bei anderen Lehrern der Schule ist diese Form von Unterricht jedoch recht unbeliebt. Die Kinder sind nicht mehr jederzeit verfügbar: Wenn sie arbeiten, wollen sie nicht gestört werden; so kann es leicht passieren, dass eine Lehrerin auf die Anweisung „Hol mir doch mal die Schere“ die Antwort erhält „Ich kann jetzt nicht, holen Sie sie selber.“
Die Schüler nehmen ihren eigenen Willen ernster; sie verweigern auch mal eine Anweisung, wenn sie deren Sinn nicht einsehen. Dies führte beispielsweise zu erheblichen Problemen, als Frau B. eine Woche krank war und eine andere Lehrerin die Klasse unterrichtete. Diese irritierte die täglich wechselnde Sitzordnung und sie wies die Schüler an, die Sitzordnung des vorigen Tages wieder einzunehmen und auch beizubehalten. Die Schüler sahen den Sinn dieser Anweisung nicht ein; sie führten sie deshalb nicht aus, sondern fingen eine Diskussion mit der Lehrerin an, die die Schüler schließlich völlig fassungslos als „unverschämt“ bezeichnete.
Auch die Überzeugung der Eltern bereitet Frau B. immer wieder große Probleme. Die meisten Eltern der Klasse sind relativ konservativ eingestellt und sähen es lieber, wenn ihre Kinder in der gleichen oder zumindest ähnlichen Form unterrichtet würden, die sie selbst auch kennen gelernt haben. Sie sind allem Neuen gegenüber prinzipiell misstrauisch eingestellt und lassen sich nicht so leicht von den Vorteilen überzeugen. Besonders in Bezug auf die Rechtschreibung, mit der Frau B. recht tolerant umgeht, gibt es immer wieder Kritik von Seiten der Eltern.
Demgegenüber sind die Kinder durchgehend begeistert von der neuen Form von Unterricht. Dies ist umso interessanter, wenn man bedenkt, dass diese Kinder den direkten Vergleich haben. Es wäre durchaus auch denkbar gewesen, dass die Kinder die Anforderungen im Werkstattunterricht, besonders in Bezug auf den Umgang mit der ungewohnten Selbstverantwortung und den neuen Freiheiten, zu anstrengend empfinden und den bequemen Frontalunterricht, bei dem einem alle Entscheidungen abgenommen werden, vorziehen würden. Doch dies ist hier nicht der Fall. Die Schüler empfinden es als positiv, dass sie im Werkstattunterricht selbstständig arbeiten können und „nicht immer nur machen müssen, was der Lehrer sagt“. Außerdem finden sie gut, „dass man sich aussuchen kann, was man machen will.“
Auch in dieser Klasse verfolgen die meisten Schüler bei der Auswahl ihrer Aufgaben bestimmte Strategien: Die meisten Schüler bearbeiten zuerst nur obligatorische Angebote, bevor sie ein freies wählen. Dahinter steht größtenteils der Gedanke an die Süßigkeiten, die man erhält, wenn man alle obligatorischen Angebote schafft; zudem hat Frau B. dieses Vorgehen empfohlen. Daneben kommen aber auch andere Strategien vor: Alexander z.B. erledigt erst die schweren Aufgaben, um sie „wegzuhaben“, anschließend macht er auch freie Angebote und zum Schluss erledigt er noch ganz schnell die leichten Angebote. Jasmin und Dora suchen sich immer erst die Aufgaben heraus, die ihnen von der Art her am besten gefallen, beispielsweise Spiele oder Lückentexte. Die Kinder sind überzeugt vom Werkstattunterricht; mit wenigen Ausnahmen arbeiten sie auch mit einer guten Arbeitsmoral. Dies mussten sie aber erst lernen; die erste Werkstatt galt deshalb als unbenoteter Probelauf. Viele Kinder berichten stolz von einer Steigerung ihrer Leistung: Sandra hatte in der ersten Werkstatt nur vier Aufgaben bewältigt, schafft jedoch mittlerweile meist neun bis zehn Angebote; ebenso hat sich David von sechs auf elf gelöste Aufgaben hin verbessert.
So kann jeder Schüler im Werkstattunterricht durch seine eigene Leistung zu Erfolgserlebnissen kommen, auch allein durch den Vergleich mit sich selbst. Die besseren Resultate der Werkstatt zeugen auch von einem Fortschritt in der allgemeinen Arbeitsmoral der Schüler; dadurch arbeiten die Schüler auch im restlichen Unterricht ganz anders, da sie ihre eigene Arbeit mehr wahrnehmen und einschätzen.
Diesen Punkt führt Frau B. auch als wesentlichen Vorteil von Werkstattunterricht an: Die Kinder verlieren zunehmend ihre Abhängigkeit und Unselbstständigkeit und beginnen, eigenständig und selbstverantwortlich zu arbeiten; sie trauen sich selbst mehr zu, lernen, eigene Entscheidungen zu treffen und erkennen den Wert ihres eigenen Willens.
7.1.3 Hauptschule in Eberbach, 5. und 6. Klasse
Die Schule besteht aus einer Werkrealschule mit angegliederter Hauptschule. Die Lehrerin, Frau Z., führt bereits seit mehreren Jahren Werkstattunterricht nach Reichen durch. Sie begann damit, als sie vor einigen Jahren eine Vorbereitungsklasse erhielt. Die Kinder dieser Klasse waren ausländischer Herkunft, sie stammten aus verschiedenen Stufen und blieben ein Jahr in dieser Klasse, um besser Deutsch zu lernen und eventuelle Defizite aufzuarbeiten, damit sie anschließend in die Regelklasse wechseln konnten. „Normaler“ Frontalunterricht wäre in dieser Klasse nicht möglich gewesen, da die Unterschiede zwischen den Schülern denkbar groß waren. Frau Z. griff deshalb auf das Konzept des Werkstattunterrichts zurück und sammelte hiermit sehr gute Erfahrungen.
Die Altersunterschiede zwischen den Kindern wurden dabei sogar zum Vorteil, da im Helferunterricht die Kinder voneinander lernen konnten. Durch neue Aussiedler- und Asylantengesetze ging die Zahl der ausländischen Kinder, die die Vorbereitungsklasse besuchen mussten, jedoch zurück, so dass eine solche Klasse schließlich gar nicht mehr zustande kam.
Frau Z. wurde nun eine 5. Klasse übertragen. Aufgrund ihrer guten Erfahrungen mit dem Werkstattunterricht beschloss sie, nach dem Konzept weiterzuarbeiten. Die restlichen Schüler der Vorbereitungsklasse nahm sie mit in die 5. Klasse auf, da sie im Werkstattunterricht nicht störten, sondern vielmehr eine Bereicherung darstellten. Ende des Schuljahrs wurden die letzten Schüler der Vorbereitungsklasse in die Regelklassen entlassen.
Frau Z. wollte jedoch das Prinzip des stufenübergreifenden Voneinanderlernens nicht mehr missen. Es gelang ihr, eine Kollegin, die eine neue 5. Klasse übernahm, von dem Konzept des Werkstattunterricht und ihrer Idee zu überzeugen. So legten die beiden Lehrerinnen die 5. und die 6. Klasse zusammen und unterrichteten nun gemeinsam. Auch die den Klassen zugeteilten Fachlehrer für Musik, Technik und Mathematik unterstützen das Werkstattprinzip.
Die Kinder der Klasse sind zum größten Teil ausländischer Herkunft, viele stammen aus den unteren sozialen Schichten. Die Leistungsunterschiede zwischen den Schülern sind sehr groß. Frau Z. begründet dies zum Teil damit, dass die Entscheidung, ob ein Kind auf die Haupt-, Realschule oder das Gymnasium kommt, sehr stark durch seine Rechtschreibkenntnisse bestimmt wird. Deshalb sind in der Klasse einige Kinder, die von ihrer Intelligenz und ihrem Wissen her zweifellos das Gymnasium besuchen könnten, die aber über miserable Rechtschreibkenntnisse verfügen und deshalb auf die Hauptschule gekommen sind.
Das Klassenzimmer besteht aus zwei aneinandergrenzenden Räumen, die durch eine Tür verbunden sind. Die Schüler sitzen an Gruppentischen zu je vier bis acht Schülern, jedoch nicht etwa nach 5. oder 6. Klasse getrennt, sondern ganz gemischt. Am Rand der Zimmer sind viele verschiedene Regale mit Büchern und Arbeitsmitteln aufgestellt, die auch einzelne Zonen, wie eine Schreibwerkstatt, eine Mathe- und eine Englischecke abgrenzen. Auch ein Computer steht zur Verfügung, der jedoch keine Lernspiele anbietet, sondern lediglich zum Schreiben von Texten genutzt wird.
In diesen Klassen ist der gesamte Unterricht auf Werkstattunterricht abgestimmt. Auch Frau Z. hat aus dem Konzept ein individuelles System entwickelt. Die Schüler erhalten jeden Tag einen Lernvertrag, auf dem die zur Verfügung stehenden Angebote eingetragen sind. Die Kinder sollen ankreuzen, was sie an dem Tag erledigt haben. Dieses System funktioniert jedoch nur sehr unzureichend. Viele Kinder nehmen diese Lernverträge nicht besonders ernst; meist bleiben die Verträge ganz unausgefüllt oder es werden wahllos irgendwo Kreuze eingetragen. Die Schüler haben dadurch keinen Überblick, was sie bereits erledigt haben und was noch nicht. Auf diese Weise ist der Sinn der Lernverträge verfehlt.
Es wäre vermutlich sinnvoller, die Schüler am Anfang der Woche eine Vorauswahl treffen zu lassen, und dann jeweils abzustreichen, welches Angebot sie bereits angefangen oder fertig gestellt haben.
Der Werkstattunterricht wird ab und zu durch verschiedene Lernzirkel ergänzt. Frontaler Unterricht wird in dieser Klasse dagegen gar nicht praktiziert. Auch das Chefsystem ist Bestandteil des Unterrichts. Die Chefs sind jedoch nicht für bestimmte Angebote zuständig, wie in den ersten beiden Beispielen, sondern eher für bestimmte Fächer oder Einrichtungen. Es gibt beispielsweise einen Spiele-, Vortrags- oder Schreib-Chef, sowie Mathe- oder Englisch-Chefs. Die Chefposten wechseln regelmäßig und werden an einer Wandtafel bekannt gemacht.
Die Angebote der Werkstatt bestehen nicht, wie in den beiden vorher beschriebenen Klassen, aus speziell für eine abgeschlossene und zeitlich begrenzte Werkstatt konzipierten Aufträgen und Arbeitsblättern, sondern sind kontinuierlich immer da und ändern sich nur bezüglich der Inhalte, nicht jedoch ihrer Form.
Für das Fach Deutsch gibt es eine Schreibwerkstatt, bestehend aus einer Wand, an der verschiedene schriftliche Anregungen zum Schreiben hängen, wie z.B. Gedichte, Geschichtenanfänge, Bilder. Jeder Schüler muss jede Woche einen Aufsatz schreiben. Diese Texte werden zunächst vom Schreibchef gesammelt und am Ende der Woche zurückgegeben.
Die Aufsätze werden dann in den Tischgruppen vorgelesen und besprochen. Jede Gruppe wählt mit einem begründenden Kommentar den jeweils besten Text. Diese Aufsätze werden später gesammelt als Buch herausgegeben.
Daneben gibt es eine Diktatkartei, bestehend aus kurzen Übungsdiktaten, die sich die Schüler gegenseitig diktieren und auch selbst kontrollieren; es gibt Sabefix-Programme und eine Kartei mit Rechtschreibübungen. Außerdem stehen verschiedene Bücher zur Verfügung, die sich die Kinder jederzeit zum Lesen holen dürfen.
In der Mathematik bildet eine Kartei aus selbst entworfenen Arbeitsblättern das Kernstück des Faches. Jeden Montag kommt der Mathematiklehrer, Herr P., in die Klasse. Jedes Kind hat nun die Aufgabe, ein Mathe-Übungsblatt zu malen. Herr P. nimmt diese Entwürfe dann mit nach Hause und überarbeitet sie, indem er Arbeitsaufträge dazuschreibt und Zeichnungen verbessert. Er fügt jedoch nichts Neues hinzu, die Schüler kommen von selbst auf neue „Kapitel“. In einer Woche (sieben Tagen) sollten die Schüler alle Übungsblätter einer solchen Kartei, meistens etwa 30 bis 40 Stück, bearbeitet haben. Anschließend wird wieder eine neue Kartei aufgebaut. Aus einer Auswahl der Übungsblätter wird später ein Buch zusammengestellt, auf dem aufbauend dann auch die Mathearbeit geschrieben wird. Die Lösungen der Blätter werden von einer der Lehrerinnen oder einem Mathe-Chef kontrolliert.
Es gibt neben den zwei Lehrerinnen vier Mathe-Chefs. Diese treffen sich regelmäßig, um Fragen zu den Arbeitsblättern zu besprechen, sowie die Ergebnisse zu korrigieren. Darüber hinaus geben die Chefs auch bestimmte Einführungen für ihre Kleingruppe. Neben den Arbeitsblättern stehen den Kindern verschiedene mathematische Spiele zur Verfügung, wie z.B. ein Mathebingo.
Für das Fach Englisch gibt es eine Englischecke, die vor allem für verschiedene Besprechungen und Vorbereitungen der Englisch-Chefs dient. Diese werden von der Lehrerin vorbereitet und arbeiten dann in ähnlicher Weise wie die Mathe-Chefs mit ihren Kleingruppen. Eine englische Schülerin der Klasse wird dabei in besonderer Weise als Hilfslehrerin eingesetzt.
Im Sachunterricht werden die meisten Inhalte über Vorträge bzw. Experimente erschlossen. Es hängt ein Plan aus, in den sich jeder Schüler, der gerne einen Vortrag zu einem bestimmten Thema halten möchte, eintragen kann. Des Weiteren hängen dort Themen und Arbeitsanweisungen für Experimente und Versuche aus, die die Schüler erst in Gruppen durchprobieren und einüben, um sie später der ganzen Klasse vorzustellen. Die Themen dieser Versuche sind sehr vielfältig, beispielsweise zählen hierzu Experimente zur Windstärkenbestimmung oder Blitzentstehung. Auch geplante Themen für Vorträge hängen dort aus, die sich die Schüler alleine oder gruppenweise aussuchen können.
Ab und zu gibt es auch so genannte Projekte, bei denen ein Thema in verschiedene Teile aufgegliedert wird und jeder Schüler der Klasse in einer Kleingruppe einen Teil als Vortrag vorzubereiten hat. So beispielsweise beim Thema „Kontinente“, bei dem pro Gruppe ein Kontinent vorgestellt wurde. Zur Vorbereitung der Vorträge stehen den Schülern eine Fülle von Ordnern und Büchern mit Sachinformationen zur Verfügung, es gibt Nachschlagewerke, Landkarten, einen riesigen Globus und alle möglichen Spiele. Jeden Tag werden ein bis zwei Stunden für die Präsentation der Vorträge und Experimente verwendet. Dazu kommen alle Schüler in einem der Klassenzimmer zusammen. Es ist erstaunlich, wie lange die Schüler den Vorträgen ihrer Mitschüler mit konzentrierter Aufmerksamkeit und Ruhen folgen. Im Prinzip handelt es sich hierbei auch um Frontalunterricht, die Tatsache, dass dieser jedoch von Schülern statt vom Lehrer gehalten wird, scheint große Auswirkungen zu haben. Besonders Frau K., die zweite Lehrerin der Klasse, ist immer wieder fasziniert von der Ausdauer und Konzentration, die dabei zu beobachten ist, da sie es gewohnt war, dass diese im „normalen“ Unterricht höchstens fünf Minuten andauert.
Ein Problem im Zusammenhang mit den Vorträgen ist jedoch das unterschiedliche Niveau der Präsentationen. Ein Schüler der Klasse wird von den Lehrerinnen nur noch „Professor“ genannt, weil er ein ungewöhnlich großes Wissen hat und Vorträge auf sehr hohem Niveau hält: mit Diashow, sehr fundiertem Hintergrundswissen und einer hohen Sprache. Die Mitschüler lauschen seinen Ausführungen zwar gebannt, es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die meisten von ihnen nur die Hälfte des Vortrags verstehen. Auf der anderen Seite zeugen viele andere Vorträge von einem sehr niedrigen Niveau, verfügen nur über einen geringen Informationsgehalt und werden in nur bruchstückhaften Sätzen vorgetragen, so dass dadurch kaum Wissen vermittelt wird.
Das System der Schülervorträge ist in gewisser Hinsicht sehr positiv zu bewerten, da es das Selbstbewusstsein der Vortragenden stärkt und eine Form des Voneinanderlernens begünstigt.
Besonders deutlich wurde dieser Aspekt bei einem russischen Jungen, von dem Frau Z. berichtete: Dieser Junge sprach kein Wort, als er in die Klasse kam. Er arbeitete im folgenden zwar gut mit und schien auch bald alles zu verstehen, sprach aber das ganze Schuljahr über kein Wort, bis er sich in der letzten Woche des Schuljahres freiwillig für einen Vortrag mit dem Thema „Wölfe“ anmeldete. Diesen Vortrag hielt er dann auch, in sehr gutem Deutsch, mit lauter Stimme und aus voller Inbrunst- und erhielt natürlich von der ganzen Klasse riesigen Beifall. Da der Aspekt der Wissensvermittlung bei den Vorträgen aufgrund der unterschiedlichen Niveaus jedoch recht kurz kommt, wäre es sinnvoll, die Themen der Vorträge anschließend in irgendeiner Weise noch zu vertiefen, beispielsweise durch eine vorbereitete Werkstatt in dem Sinne der beiden bisher vorgestellten. Frau Z. hat jedoch in diesem Zusammenhang eine sehr extreme Sicht. Sie ist überzeugt, dass eine solche Vertiefung der Vorträge durch Arbeitsblätter o.ä. sinnlos wäre, da sich diese schriftlichen Arbeiten ihrer Meinung nach später sowieso niemand mehr anschaut. Außerdem ist sie der Überzeugung, dass die Kinder das, was sie bis jetzt nicht gelernt haben, auch in der Zukunft nicht mehr lernen werden. Diese Einstellung vertritt sie besonders auch in Bezug auf die Rechtschreibung, auf die sie deshalb kaum Wert legt.
Diese Einstellungen sind jedoch zweifelhaft, wenn man bedenkt, wie viele Schüler zunächst sehr schlecht in der Schule waren und dann später in der Pubertät endlich zu einem ganz anderen Arbeiten und dadurch auch besseren Schulleistungen kommen. Außerdem ist es nicht zu rechtfertigen, den Schülern von vornherein zu unterstellen, dass sie sich im Nachhinein nie wieder mit den Ausarbeitungen eines Themas beschäftigen, wenn dies auch sicher bei einem Großteil der Schüler zutrifft, so sollte man denjenigen, die diese Ausarbeitungen als persönliche Nachschlagewerke nutzen würden, diese Möglichkeit nicht nehmen. Darüber hinaus wäre eine Vertiefung des Gehörten durch die eigene Beschäftigung mit den Inhalten sicherlich nicht sinnlos, sofern an die Methoden- und Sozialkompetenzen gedacht wird, die über das fachliche Lernen hinaus erworben werden.
Positiv hervorzuheben ist die Atmosphäre in der Klasse; die Kinder wirken sehr fröhlich und offen, es ist zwar relativ laut, was aber hauptsächlich durch die Arbeit bedingt ist. Die meisten Kinder arbeiten, und zwar mehr oder weniger intensiv an verschiedenen Dingen. Ein Überblick ist sehr schwer zu gewinnen, da dies durch die insgesamt fast 50 Kinder der zwei Klassen zusätzlich erschwert wird. Natürlich gibt es auch einige Kinder, die die Freiheit missbrauchen und nur sehr wenig leisten. Es ist jedoch fraglich, ob diese vom „normalen“ Frontalunterricht mehr profitieren würden. Wahrscheinlich ist, dass sie dort lediglich durch ihre Unaufmerksamkeit den Unterricht stören würden, was hier nicht der Fall ist.
Ein Mädchen der Klasse ist sehr viel jünger als die übrigen Kinder; es würde eigentlich in die 2. oder 3. Klasse gehören. Wie Frau Z. erklärte, ist sie die Schwester eines Jungen der Klasse. Es handelt sich dabei um Aussiedlerkinder, die keiner Schulpflicht unterliegen. Das Mädchen kann noch kaum Deutsch, es kann nicht lesen und schreiben und wäre in einer normalen Klasse, die frontal unterrichtet wird, völlig verloren. Ihr Bruder bringt sie deshalb mit in den Werkstattunterricht, wo sie von Frau Z. spezielle Übungen erhält und ihrem eigenen Lernstand und -tempo gemäß ohne jeden Druck lernen kann.
Frau Z. sieht mehrere besondere Vorteile des Werkstattunterrichts in Bezug auf die Hauptschule: Sie berichtet, dass die Kinder häufig große Frustration und Schulunlust zeigen, wenn sie in die Hauptschule kommen. Sie sind sich bewusst, dass sie in der „niedrigsten“ Schulart gelandet sind und haben oftmals das Gefühl, versagt zu haben bzw. „ja sowieso nichts zu können“. Es ist deshalb gerade in dieser Schulart von größter Bedeutung, den Schülern Erfolgserlebnisse zu vermitteln und ihnen zu zeigen, dass sie in ihrem Rahmen sehr wohl etwas leisten können. Hierzu eignet sich der Werkstattunterricht in besonderer Weise. Vor allem eröffnet er den Schülern auch die Möglichkeit, eigene Interessen zu entdecken und entlang dieser mit neuer Motivation dazuzulernen. Die Schüler erlangen durch das zugestandene Vertrauen ein besseres Selbstbewusstsein und dadurch auch mehr Mut, Entscheidungen zu treffen und selbst Verantwortung für ihr Lernen und ihr Leben zu übernehmen.
Die zweite Lehrerin der Klasse, Frau K., hatte besonders am Anfang große Schwierigkeiten mit dieser für sie ungewohnten Unterrichtsform. Ihr fiel es beispielsweise schwer, Fragen der Kinder nicht direkt zu beantworten, sondern sie stattdessen zum zuständigen Chef zu schicken, und sie musste sich sehr zurückhalten, um nicht ständig einzugreifen und die Kontrolle wieder an sich zu nehmen. Das „qualifizierte Nichtstun“ bereitete ihr große Schwierigkeiten. Sie vertraute jedoch auf Frau Z.s Erfahrung und sah auch bald einige Vorteile des Werkstattunterrichts gegenüber dem gewohnten Frontalunterricht. Sie erkannte beispielsweise, dass die Schüler zwar nicht durchgängig arbeiteten, sondern viele Pausen machten, was sie ja im „normalen“ Unterricht genauso tun, nur weniger offensichtlich, dass sie aber, wenn sie dann arbeiteten, ihre Aufgaben mit einer weit höheren Konzentration und Intensität erledigten. Des Weiteren wird nach ihren Beobachtungen das soziale Miteinander durch den Werkstattunterricht in besonderer Weise gefördert, das Klima in der Klasse ist viel entspannter und es kommt zu weniger Aggressionen und Auseinandersetzungen. Dies ist ein weiterer bedeutender Vorteil, der für die Durchführung von Werkstattunterricht gerade auch in der Hauptschule spricht.
Die Meinungen der Schüler bestätigen diese Darstellung. Die Schüler haben alle in der Grundschule Frontalunterricht erlebt und können daher den direkten Vergleich ziehen. Der Großteil der Schüler ist mit dieser anderen Art von Unterricht sehr zufrieden, die Gründe dafür decken sich mit denen der Klassen in den ersten beiden Beispielen: sie sind sich der Vorteile, die ihnen der Werkstattunterricht bietet, voll bewusst. Einige Kinder berichten davon, dass es anfangs nicht einfach war, alles selbst entscheiden zu müssen und sich seine Arbeit selbst einzuteilen, dass sie dies aber recht schnell gelernt haben. Manche Kinder bemängeln, dass der Unterricht oft langweilig wäre. Die Frage, ob der andere frontale Unterricht, den sie vorher erfahren haben, denn besser gewesen wäre, verneinen sie jedoch ebenfalls. Es handelt sich dabei auch um die Kinder, die nicht recht etwas mit ihrer Zeit anzufangen wissen und noch eine ziemlich ungefestigte Arbeitsmoral haben. Alle befragten Schüler würden sich, wenn sie die Wahl zwischen Frontal- und Werkstattunterricht hätten, deutlich für den Werkstattunterricht entscheiden.
Die Überzeugung der Eltern stellte in dieser Klasse nur ein geringes Problem dar. Aufgrund von Frau Z.s langjähriger Erfahrung fassten bereits die Eltern der ersten fünften Klasse schnell Vertrauen; die Eltern der nächsten fünften Klasse wurden zudem durch die positiven Berichte der Eltern der mittlerweile sechsten Klasse überzeugt. Hinzu kommt, dass sich ein Großteil der Eltern der Kinder nur sehr wenig um die Schule kümmert, und deshalb auch keine Einwände hat.
Frau Z. und Frau K. sind beide sehr zufrieden mit der Durchführung des Werkstattunterrichts; besonders Frau Z. kann sich nicht mehr vorstellen, in anderer Weise zu unterrichten. Als Vorteile des Werkstattunterrichts heben sie besonders die Vermittlung von Erfolgserlebnissen und das Arbeiten ohne Druck hervor. Daneben ist die Anpassung an sehr unterschiedliche Leistungsniveaus zu nennen, sowie die Förderung der Sozialkompetenzen.
7.2 Zusammenfassung
Das Werkstattunterrichtskonzept bietet viele Möglichkeiten der praktischen Umsetzung. An den drei Beispielen wird bereits die Breite der Einsatzmöglichkeiten deutlich: Schon zeitlich liegt die Anwendung des Werkstattunterrichts zwischen einer Stunde täglich und dem gesamten Unterricht. Auch methodisch kann jeder Lehrer das Konzept entsprechend seinen Ansprüchen variieren und eigene Schwerpunkte setzen. Beispielsweise wird das Chefsystem als wesentlicher Aspekt des Konzepts zwar von allen drei Lehrern angewandt, jedoch mit unterschiedlichen Regeln und Ausprägungen. Jeder der Lehrer ist jedoch von der Wirksamkeit des Konzepts überzeugt.
Die Vor- und Nachteile, die von den Lehrern genannt werden, stimmen größtenteils mit denen überein, die auch Reichen (1991, S. 84 f.) in seinen Ausführungen angibt. Demnach wurden als Vorteile u.a. die Individualisierung und Intensivierung des Lernens genannt, die Förderung von Selbständigkeit und Handlungskompetenz sowie die größere Bewegungsfreiheit der Kinder. Ein Problem des Werkstattunterrichts sieht Reichen (persönl. Mitteilung, 22.11.1999) darin, dass „das Konzept verwöhnend wirken kann, wenn Kinder keine geistige Disziplin haben.“ Die befragten Lehrer bestätigten, dass einige Kinder mit dem Prinzip des Werkstattunterrichts ihre Probleme haben, weil es ihnen schwer fällt, ihren Arbeitsprozess zu organisieren und Selbstverantwortung dafür zu übernehmen. Sie sehen darin jedoch keinen Grund, diese Unterrichtsform nicht durchzuführen, sondern werden durch diese Tatsache eher noch darin bestärkt. Die Fähigkeiten an denen es den genannten Schülern mangelt, werden sie ihr ganzes Leben lang brauchen, deshalb ist es von größter Wichtigkeit, dass diese erlernt werden, und das können sie im Werkstattunterricht. Darauf weist auch Reichen (1991, S. 133) hin: „Der ideale Schüler fällt nämlich nicht vom Himmel [...]: Er wird zu diesem Schüler durch den Unterricht erzogen! Das geschieht nicht an einem Tag und nicht in einem Monat – aber es ist zu erreichen.“
Einige Beobachtungen führten zu weiteren Erkenntnissen: Als „neuer“ Nachteil, den Reichen nicht anführt, stellte sich der störende Nebeneffekt des Chefsystems heraus. Hierbei muss jeder Lehrer selbst entscheiden, was ihm wichtiger ist: Die positiven Auswirkungen des Chefsystems auf Selbst- und Sozialkompetenzen oder aber die Freiheit der Schüler von den Unterbrechungen und Störungen. Sicher lassen sich dabei auch verschiedene Kompromisse finden, wie schon das zweite Beispiel zeigt.
Reichen führt an, dass die veränderte Lehrerrolle im Werkstattunterricht zunächst große Probleme bereiten kann. Dies trifft bei Lehrern, die bereits viele Jahre frontal unterrichtet haben, zu, wie auch Frau K. in der Hauptschule Eberbach bestätigt. Von jungen Lehrern, deren Examen noch nicht so weit zurückliegt, wird diese andere Lehrerrolle jedoch im Gegenteil als sehr positiv und viel natürlicher empfunden. Herr R. wollte von Anfang an niemals frontal unterrichten, und auch Frau B. fühlte sich in der Rolle der frontalen Lehrerin sehr unwohl. Dies könnte eventuell auf veränderte Rollenerwartungen oder ein neues Selbstbild als Lehrperson hindeuten, das vielleicht durch neue Aspekte in der Lehrerbildung gefördert wurde. Doch auch Lehrer, die viele Jahre frontal unterrichtet haben, können die Umstellung schaffen, wie das Beispiel von Frau Z. und Frau K. zeigt. Frau Z. war nach langjähriger „Frontalerfahrung“ sogar der festen Überzeugung, dass sich die Unterrichtspraxis allgemein ändern muss, da Unterricht in der Zukunft gar nicht mehr anders möglich sein wird, insbesondere in der Hauptschule.
Die Anforderungen an den Lehrer sind sehr hoch: Er muss belastbar sein und organisieren können. Weiterhin muss er lernen, Verantwortung an die Schüler abzugeben, eine höhere Lautstärke zu ertragen, Fehler zulassen zu können und auszuhalten, den Überblick zu verlieren. Reichen führt weiterhin als einen Nachteil an, dass die Durchführung von Werkstattunterricht einen ungleich höheren Arbeitsaufwand an Vor- und Nachbereitung mit sich bringt. Diese Tatsache wird zwar durchgängig von allen befragten Lehrern bestätigt, sie wird jedoch nicht negativ gesehen. Die Lehrer berichten vielmehr von einer größeren Arbeitszufriedenheit und davon, dass sie zwar mehr Arbeit haben, als für frontalen Unterricht nötig wäre, dass ihnen diese Arbeit aber viel sinnvoller erscheint und deshalb auch mehr Spaß bereitet.
Es ist allerdings zu beachten, dass es sich um sehr engagierte Lehrer handelt, die wahrscheinlich auch vorher schon mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung ihres frontalen Unterrichts verwendet haben. Es ist anzunehmen, dass sich hauptsächlich solche Lehrer für die Durchführung dieses offenen Unterrichtskonzepts entscheiden, die sich des höheren Arbeitsaufwandes bewusst sind, ihn aber für einen besseren Unterricht gerne in kauf nehmen. Des Weiteren haben die Beispiele gezeigt, dass für die meisten Schüler eine Umstellung von Frontal- auf Werkstattunterricht relativ problemlos möglich ist, insbesondere, weil das Konzept des Werkstattunterrichts eine schrittweise Einführung dieses offenen Unterrichtskonzepts ermöglicht. So kann man, wie Frau B. zunächst mit nur einer Stunde Werkstattunterricht am Tag beginnen, um ihn dann langsam auszuweiten. Auf diese Weise lässt sich auch die Vorbereitung vermindern, da man so einen Fundus an Werkstattmaterial ansammeln kann, worauf man später zurückgreifen kann.
Als größter Vorteil des Werkstattunterrichts wird immer wieder die Förderung der Selbstständigkeit, Selbstverantwortung und des Selbstbewusstseins der Schüler herausgestellt. Alle befragten Lehrer stimmen darin überein, dass sie den Werkstattunterricht für die optimale Unterrichtsform zur Förderung dieser Ziele halten. Der Werkstattunterricht hat Auswirkungen auf den ganzen Schulbetrieb, wie das zweite Beispiel besonders deutlich zeigt.
Alle Lehrer weisen auf eine höhere Motivation und ein konzentriertes Arbeiten der Kinder hin, das so im „normalen“ Unterricht nur sehr selten erreicht wird. Bezeichnend ist, dass jeder der befragten Lehrer davon überzeugt ist, auch weiterhin Werkstattunterricht durchzuführen und dieses Unterrichtskonzept jederzeit anderen Lehrern, die ihren Unterricht öffnen wollen, weiterempfehlen würde. |



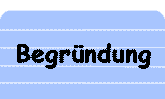


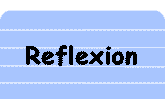
 einem Tisch steht. Die verschiedenen Arbeitsblätter und Aufträge sind dort in jeweils einem Hängeordner nach Nummern sortiert zu finden. An jedem solchen Ordner eines Angebots klebt ein Zettel mit dem Namen des zuständigen Chefs.
einem Tisch steht. Die verschiedenen Arbeitsblätter und Aufträge sind dort in jeweils einem Hängeordner nach Nummern sortiert zu finden. An jedem solchen Ordner eines Angebots klebt ein Zettel mit dem Namen des zuständigen Chefs. Wenn sich ein Schüler für eine Aufgabe entschieden hat, liest er den Namen des zuständigen Chefs ab, geht zu ihm und lässt sich erklären, was zu tun ist.
Wenn sich ein Schüler für eine Aufgabe entschieden hat, liest er den Namen des zuständigen Chefs ab, geht zu ihm und lässt sich erklären, was zu tun ist.