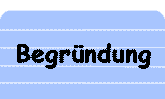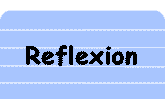3.
Theoretische und praktische Begründung
>>
3.1. theoretische Begründung
>> 3.2. prakttische Begründung
3.1. Theoretische Begründung
Viele unterschiedliche Konzepte liegen dem Offenen Unterricht zugrunde (z.B. Montessori, Petersen, Freinet, Antiautoritäre Erziehung etc.). Offener Unterricht entspricht aber keiner dieser Theorien, da es sich bei diesen Konzepten lediglich um Einflüsse handelt. Offener Unterricht war und ist daher einer dauernden Veränderung unterworfen und selbst ein sehr offenes Konzept.
Vorläufer des Offenen Unterrichts sind unter anderem Strömungen aus der Reformpädagogik, die teilweise ein Denken „vom Kinde aus“ betont und eine „Schule für Kinder“ zu gestalten sucht. Die Reformpädagogik kann nicht als geschlossene „Bewegung“ bezeichnet werden. Der Begriff „Reformpädagogik“ kann lediglich als ein Oberbegriff gesehen werden, der vielfältige, miteinander konkurrierende Strömungen verbindet. Auf diesen sehr unterschiedlichen Konzepten basierend entstanden auch Alternativschulen (z.B. Montessori-, Petersen-, Freinet- und Waldorfschulen). Auch die „freien Alternativschulen“, die Anfang der siebziger Jahre aus den antiautoritären Erziehungsansätzen hervorgingen, stellten die traditionelle Unterrichtspraxis in Frage und führten neue Konzepte ein.
Veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingen, neue pädagogische und lernpsychologische Erkenntnisse, sowie nicht zuletzt der „Sputnik-Schock“ (Russland setzt den ersten Weltraum-Satelliten) lösten schon in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts eine Diskussion um eine Neugestaltung von Schule aus. Es kam zu Forderungen nach Differenzierung bzw. Individualisierung und einer größeren Wissenschaftsorientierung sowie einer höheren Ganzheitlichkeit. Diesen Forderungen wurde in neuen Bewegungen in der Pädagogik Rechnung getragen. Im Gegensatz dazu standen jedoch die Ergebnisse der Lehrplankommissionen, die stark behavioristisch orientierte, kleinschrittige Stundenvorgaben machten. Dies ließ die Forderung nach handlungsorientierten bzw. offenen und individuell beeinflussbaren Curricula laut werden. Der darin liegende Streit hält bis heute an, wobei in Deutschland insbesondere eine enorme Stofffülle zu beklagen ist, die handlungsorientiertes Unterrichten erschwert.
In den letzten Jahren kam es zunächst durch die Erkenntnisse des „radikalen Konstruktivismus“ und dann des interaktionistischen Konstruktivismus zu einem Paradigmenwechsel in der Didaktik. Die traditionelle, entweder behavioristisch geprägte Unterrichtsidee vom (Be-)Lehren oder die bildungstheoretische Dominanz der Inhalte weicht zunehmend einer Überzeugung, die das selbstbestimmte Entdecken des Lerners und seine konstruktiven Tätigkeiten in den Vordergrund stellt. So werden auch vermehrt die herkömmlichen Lehr- und Lernmethoden in Frage gestellt und es wird nach Formen gesucht, die einen individualisierten, vom Schüler selbst gesteuerten Unterricht ermöglichen.
Allerdings ist auch kritisch anzumerken, dass alle Konzepte offenen Unterrichts eine deutliche Begründungsschwäche in sich tragen. Da sie überwiegend von methodischen Konzepten her argumentieren, fehlt ihnen eine ganzheitliche Sicht auf die Didaktik. Im Gegensatz zur „Konstruktivistischen Didaktik“ oder anderen didaktischen Ansätzen wirken sie daher oft fragmentarisch und in der Herleitung recht willkürlich. Insbesondere setzen sie sich, wie man bei Peschel sehr gut sehen kann, zu wenig systematisch mit dem umfassenden Gebiet der Didaktik systematisch auseinander und erzeugen oft den Eindruck einer reinen Praxislehre, die in oberflächlichen Begründungsfiguren stecken bleibt. Hier hängt es ganz und gar von der Leserin/dem Leser ab, mit wie viel gutem Willen der eigentlich vom Ansatz her sinnvolle Weg mitgegangen werden kann. Unverständlich bleibt, weshalb die Vertreter des Offenen Unterrichts
- noch zu sehr in der Reformpädagogik stecken bleiben, naturalistische Weltbilder betonen und die aktuellen Entwicklungen insbesondere in internationalen didaktischen Ansätzen wenig mitvollziehen;
- deshalb auch keinen systematischen Anschluss an konstruktivistische Lernansätze suchen, obwohl diese ihnen sowohl aus der Sicht der Didaktik als auch der sozial-kognitiven Lernpsychologie genügend Basis und Begründungen für ihre Ansichten geben könnten;
- nur bestimmte Unterrichtsmethoden favorisieren, andere aber völlig vernachlässigen, obwohl auch andere Unterrichtsmethoden sich in der Handlungsorientierung als außerordentlich erfolgreich bewährt haben.
Auf Grund dieser Mängel erscheinen Konzepte des Offenen Unterrichts heute eher als „Meisterlehren“ von „Meisterlehrern“, was für die Praxisorientierung oft gar nicht schlecht sein muss, aber für die Begründungsreichweite des didaktischen Ansatzes als unzureichend erscheint. Angesichts der konstruktivistischen Wende in der internationalen Didaktik erscheint dieses Vorgehen als wenig plausibel. Insbesondere überwindet es nicht die Schwächen einer Pädagogik vom Kinde aus, die sich noch heutigen wissenschaftlichen Konzepten in der Didaktik nicht mehr aufrechterhalten lässt. Die Didaktik ist auch in wissenschaftlich begründeten Ansätzen bereits praktisch geworden, so dass der Offene Unterricht sich mitunter Gegner imaginiert, die gar nicht mehr in der Theorie, sondern eben auch in der Praxis sitzen.
3.2. Praktische Begründung
Offener Unterricht soll sich auf alle Unterrichtsprozesse beziehen, ist aber vorrangig im Bereich der Grundschule vertreten. Dies hängt vor allem mit den Praktikern dieses Ansatzes zusammen, die überwiegend in diesem Bereich tätig sind.
Offener Unterricht soll Formen handlungsorientierten Lernens vertreten, welches die kindlichen Bedürfnisse nach Ausprobieren, Erkunden und praktischem Tun berücksichtigen will und so ein „Lernen aus erster Hand“ bewusst aufzuwerten bestrebt ist. Dieses setzt einen Gegenpol zu einer Lern- und Lebenswelt, in der Kinder die Umwelt zunehmend isoliert und „aus zweiter Hand“ (medial vermittelt, durch z.B. Fernsehfilme, Werbung, Computerspiele) erfahren. Offene Unterrichtsformen, besonders die Freie Arbeit, sollen dabei im hohen Maße dem Lernrhythmus des einzelnen Kindes entsprechen. Sie sind besonders dafür geeignet, dass sich jedes Kind unterschiedlich, eigenständig (ggf. auch nur mit zusätzlicher Anleitung und Hilfe), individuell und differenziert Unterrichtsinhalte an strukturierten Materialien erarbeiten, einüben und so den Lernprozess selbstständig überprüfen kann. Die Kinder haben die Möglichkeit, auf ihrem Niveau, nach ihrem Tempo und nach ihrer entsprechenden Zugriffsweise lernen zu können. Dies schließt insbesondere an reformpädagogische Strömungen, wie sie vor allem durch Freinet bekannt wurden, an.
In offenen Unterrichtsformen soll die Forderung der Lernpsychologie nach Nutzung vieler Eingangskanäle und ganzheitlichem Erleben zum Zwecke der Leistungssteigerung im Sinne eines richtliniengerechten Leistungsbegriffs erfüllt werden. Allerdings zeigen die Beispiele der Vertreter des Offenen Unterrichts eine eigentümliche Beschränkung auf bestimmte Methoden, die offensichtlich durch die Begrenztheit der eigenen Praktiken gewonnen werden. Es ist wenig ein innovativer Gebrauch von Methoden erkennbar, wie er in der Breite möglich wäre (z.B. durch Einschluss von Methoden, wie wir sie im Methodenpool beschreiben, wie Problem Based Learning, Storyline, Jigsaw und viele andere mehr, die eigentlich der Intention des Ansatzes gut entsprechen würden). Hier macht sich der Ansatz einer „Meisterlehre“ sehr negativ bemerkbar, denn der Rezipient des Offenen Unterrichts, besonders Studierende, können oft zu wenig einschätzen, in welcher Gefangenschaft des methodischen Denkens sie sich befinden. Da es keine Begründung im Sinne eines Für oder Wider von Methoden im Sinne ihrer Multiperspektivität, Multimodalität und Multiproduktivität gibt, wie es die Konstruktivistische Didaktik nach Reich fordert, bestehen hier wenig Chancen auf einen Dialog, der die Begründungen selbst hinterfragt und aus dem so doch recht engen normativen Konzept bloßer Praxislehre aussteigt.
Die Begründungsfiguren des Offenen Unterrichts verbleiben rein praktisch. Wissenschaftliche Literatur zur Begründung wird selten oder nur bruchstückhaft herangezogen. Es dominiert eine praktische Plausibilitätsebene, die eher normativ und moralisch vertreten wird, was den Charakter einer „Meisterlehre“ verstärkt.
Trotz dieser kritischen Einschränkungen können zahlreiche Anregungen aus den praktischen Konzepten gezogen werden. So sollen regelmäßige Planungs- und Entscheidungsphasen im unterrichtlichen Geschehen die Persönlichkeitsentwicklung stärken. Hier wird eine Beziehungsdidaktik eröffnet, die ähnlich wie in der Konstruktivistischen Didaktik soziale Verhaltensweisen wie Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und Empathie in relativ offenen Unterrichtsformen regelmäßig fordern und entwickeln will. Allerdings ist wiederum kritisch anzumerken, dass diese Beziehungsdidaktik nur sehr begrenzt nach ihren interaktiven und kommunikativen Seiten entwickelt wird und vielfach in Pauschalurteilen stecken bleibt.
Die Auswahl der Inhalte orientiert sich (unter Berücksichtigung der Richtlinien und Lehrpläne) stärker als Konzepte traditionellen Unterrichts an der Lebenswirklichkeit der Kinder. Schulisches und außerschulisches Lernen, vor allem bei projektorientierten Vorhaben, ist produkt- und problemorientiert und soll lehrgangsartiges, sachlogisches Lernen durch fächerübergreifendes Lernen mit „Kopf, Herz und Hand“ ersetzen oder ergänzen. Das Gewinnen von Erkenntnissen auf selbst gewählten Wegen bedeutet mit großer Wahrscheinlichkeit den Gewinn einer aktiven und forschenden Arbeitshaltung im Sinne eines „Entdeckenden Lernens“ und die Förderung von Lernfreude. Hier erwächst aus anfangs ganzheitlich erlebten Zusammenhängen die Notwendigkeit systematischen Forschens und Lernens.
Erkenntnisse zur veränderten Kindheit und einige Stichworte aus der aktuellen Lernforschung (die von den Vertretern Offenen Unterrichts allerdings nicht systematisch ausgewertet wird), verbunden mit einem Bildungsauftrag der Schule, welche zugleich Lebens-, Lern- und Erfahrungsraum sein soll, in dem alle Kinder mit ihren unterschiedlichen Lernmöglichkeiten zusammen lernen können und wollen, führt auch zu erweiterten Zielen für einen Offenen Unterricht, die unter anderem in der Vermittlung so genannter Schlüsselqualifikationen liegen:
Sachkompetenz
- Lernen von bedeutsamen und sinnzusammenhängenden Inhalten, die der Lebenswelt und Lernfähigkeit der Kinder entsprechen
- Lernen des Lernens (Vermittlung verschiedener Lerntechniken, welche unterschiedlichen Lerntypen entsprechen sollen)
Sachkompetenz bilde ich dann am besten aus, wenn ich die Art und Weise der Auseinandersetzung mit einer Sache selbst beeinflussen kann, und zwar am effektivsten in der Form, dass ich nicht nur über die Art der Aneignung, sondern auch über den Lerninhalt, das heißt die Sache selbst, bestimmen oder mitbestimmen kann.
Selbstkompetenz
- Erziehung zur Selbständigkeit (Aktivitäten planen, durchführen und auch abschließen)
- Durchhaltevermögen
- Selbstvertrauen
Selbstkompetenz lerne ich durch die Übernahme der Verantwortung für mein Lernen – und zwar einerseits auf organisatorischer Ebene, indem ich als Lernender Zeitpunkt, Reihenfolge, Ort und Lernpartner bestimme, aber auch auf methodischer Ebene, indem ich statt eines Lehrgangs möglichst meinem eigenen Lernweg folge und selbst für Materialien, Informationen und den Austausch mit anderen sorge.
Sozialkompetenz
- Entwicklung und Entfaltung von Kooperationsfähigkeit / Arbeit im Team
- Fähigkeit zur Konfliktbewältigung
Sozialkompetenz, die Verantwortungsübernahme für den Einzelnen und die Gruppe, präge ich dann am besten aus, wenn ich die Regeln und Strukturen des Zusammenlebens mitgestalten kann bzw. in deren Entstehungsprozess involviert bin – und zwar nicht in der Form der üblichen „Alibi-Abstimmungen“, bei denen alle Beteiligten vorher wissen, was „richtig“ ist, sondern in einem die Individualität und Meinung des Einzelnen respektierenden Prozesses ständiger Auseinandersetzung.
Diese Aussagen sind aus anderen Konzeptionen übernommen, wobei der stark partizipative Gedanke nicht nur an Freinet erinnert, sondern noch deutlicher von John Dewey vertreten wurde.
Nach Peschel liegen dem Offenen Unterricht die in Lehrplänen und Rahmenrichtlinien geforderten didaktisch-methodische Prinzipien zugrunde:
1. Lebensbedeutsamkeit, Anwendungs- und Situationsorientierung
Eine Situation ist dann lebensbedeutsam, wenn das Kind gerade jetzt für ein bestimmtes Problem eine Lösung sucht. Der Offene Unterricht macht weder Prinzip noch Fach oder Methode zur Grundlage seiner Überlegungen, sondern versucht direkt vom einzelnen Kind her zu denken. Lässt man das Kind selbst seine Inhalte zusammenstellen, seine Probleme finden und lösen, so wird den Prinzipien der Situationsorientierung bzw. der Lebensbedeutsamkeit schon zu einem großen Teil ganz automatisch Rechnung getragen. Es kann auf aufgesetzte Motivationsphasen durch den Lehrer verzichtet werden. Das Kind bekommt die Möglichkeit zu eigengesteuertem Lernen, das diesem durch die eigene Zielsetzung auf jeden Fall eher transparent und sinnvoll erscheint als etwas nur Nachgemachtes. Zudem hat der Lehrer im Offenen Unterricht durch seine (unverbindlichen) Impulse immer die Möglichkeit, zusätzliche Interessen zu wecken, und kann dabei die wirkliche Lebensbedeutsamkeit des Inhalts in der momentanen Situation überprüfen.
Problematisch an diesem Konzept ist allerdings die naturalistische Einstellung zum Kind. Peschel sieht zu wenig, dass eine Pädagogik vom Kinde aus immer schon ein Konstrukt bestimmter Pädagogen mit bestimmten Normen ist. Das „Kind an sich“ ist so eine bloße Fiktion, in das munter die Vorurteile des Zeitalters abgebildet werden können. Naiv wird dies dann, wenn die eigenen Herleitungen nicht mehr kritisch reflektiert und die gesellschaftlichen Kontexte ganz und gar verkannt werden. Wenn „vom Kinde aus“ argumentiert wird, dann schleichen sich viele pädagogische und moralische Normen von „richtig“ und „falsch“ ein, die unhinterfragt den Eindruck der „Meisterlehre“ verstärken.
2. Handlungsorientierung, Selbsttätigkeit und Produktorientierung
Es geht hierbei vor allem um den inneren Bezug des Lernenden zur Tätigkeit „selbst“. Die handelnde Auseinandersetzung mit einem Inhalt, mit dem sich das Kind wirklich identifiziert, die Möglichkeit, sich mit einer Sache auf eigenem Weg auseinandersetzen und so aktiv eigene Erfahrungen machen zu dürfen.
Es geht darum, Handlungsorientierung als Grundprinzip des Unterrichts vom Kinde aus zu denken und nicht darum, jedes Thema durch irgendwelche praktischen Sequenzen anzureichern. Dass bei dieser Sichtweise das Tun der Kinder ganz automatisch erfolgt, und ganzheitliche, individuelle Zugänge durch die Eigenaktivität und Selbststeuerung der Kinder von selbst Einzug halten, liegt auf der Hand.
Beim Prinzip der Produktorientierung ist nicht das materielle Produkt als solches wichtig, sondern das auf ein bestimmtes Produktziel gerichtete Handeln des Kindes. Es geht also nicht primär um das Erstellen einer Sache, sondern um eine sinnvolle Auseinandersetzung mit einem Problem, dessen Lösung als „Lernprodukt“ dem Lernenden eine Identifikation ermöglicht.
Peschel hätte hier die Möglichkeit gehabt, seinen Ansatz wissenschaftlich durch eine Auseinandersetzung mit Deweys Konzept des experience zu fundieren. Dann wäre er allerdings darauf gekommen, dass diese Begründungsfigur heute in der Konstruktivistischen Didaktik breit entfaltet wird. Hier verwundert es schon, dass bereits bestehende Theorien im Konzept des Offenen Unterrichts gar nicht aufgegriffen werden, dass sich die Praktiker damit ganz von der Theorie abkoppeln.
3. Ganzheitlichkeit, „Lernen mit allen Sinnen“ und fächerübergreifendes Prinzip
Ziel des Offenen Unterrichts ist es, dass der Lernende möglichst optimal lernen kann, indem man den für ihn besten Weg der (Stoff-) Aufnahme nicht blockiert. Aber es geht nicht darum, in jeder Situation den „zu vermittelnden Stoff“ im Hinblick auf die Aufnahme durch verschiedenste Sinneskanäle zu transformieren, die dann von allen Kindern obligatorisch durchlaufen werden müssen, egal ob der Schüler diesen Zugang wirklich benötigt oder nicht.
Denkt man Ganzheitlichkeit vom Kinde aus, so nimmt man es als Person, als Individuum wahr. Dann muss Ganzheitlichkeit im Sinne eines natürlichen Lernens verstanden werden. Man lässt dem Kind weitgehende Inhalts-, Methoden- und Zeitfreiheit, gibt ihm durch unverbindliche Impulse Hilfen beim Gehen des eigenen Weges und beim Erweitern der eigenen Erfahrungen, gestattet die Verwendung verschiedenster Techniken und Materialien und lässt die Eingangskanäle und Sinne zu, mit denen das Kind lernen will. Aber man versucht nicht dort Ganzheitlichkeit von außen zu inszenieren, wo gar keine vorhanden ist.
Bezogen auf das fächerübergreifende Prinzip geht man beim Offenen Unterricht davon aus, dass der Zugang des Kindes zur Welt ein vorfachlicher ist. Denn die Einteilung der Welt in bestimmte fachliche Strukturen ist eine relativ willkürliche Sache, eine historische bzw. gesellschaftliche Entwicklung. Für das Kind muss das zu lösende Problem bzw. das zu erlernende Wissen im Vordergrund stehen.
Auch hier wird eine sehr einfache Begründungsfigur gewählt, die zu wenig sieht, dass auch das angeblich natürliche Kind bloß eine Konstruktion von Erwachsenen ist. Konstruktivistische Ansätze beschreiben sehr viel deutlicher und differenzierter, was am Konstrukt Kind problematisch ist und weshalb die Kontexte von Kindheitskonstruktionen nicht übersehen werden sollten (vgl. z.B. einführend:
http://www.uni-koeln.de/hf/konstrukt/reich_works/aufsatze/reich_21b.pdf )
4. Elementarisierung und Kindorientierung
Es scheint die Grundaufgabe jeder Didaktik zu sein, die komplexe Lebenswirklichkeit bzw. die schulisch relevanten Inhalte so zu transformieren, dass dem Lernenden ein einfacher und sicherer Zugang ermöglicht wird. Wenn jedoch das Endziel der Elementarisierung die Begegnung mit der komplexen Wirklichkeit ist, sollte man das Kind nicht durch einen fiktiven Zugang über- oder unterfordern. Vom Kinde aus betrachtet ist es viel schwieriger und unsicherer, in einem sich selbst noch nicht erschlossenen Gebiet einen fremden Weg, einer fremden Struktur zu folgen, als sich selbst einen Weg zu bahnen. Entsprechend ist zu bezweifeln, ob (auch junge oder schwache) Kinder auf die Elementarisierung durch andere angewiesen sind oder ob sie diese nicht am besten selbst vornehmen sollten – wie sie es ja auch den Rest des Tages tun.
Voraussetzung für eine solche eigengesteuerte Vorgehensweise ist allerdings die Fehlertoleranz durch den Lehrer und Eltern, die die jeweilige Entwicklungsstufe des Kindes berücksichtigt. Dabei ist zu beachten, dass sich die Entwicklungsstufe eben nicht durch ausgeklügelte didaktische Maßnahmen anheben lässt (vgl. Peschel, 2002).
Auch hier erscheint das Konzept der Kindorientierung als schwierig. In einer arbeitsteiligen Welt in der Postmoderne greifen die alten Bilder von natürlich und künstlich längst nicht mehr so umfassend wie vor 100 Jahren. Hier wird unterstellt, dass aus dem Kind heraus genügend Neugierde und Antriebe vorhanden sind, gleichsam so, als seien die Kinder nicht auch Teil ihrer Umgebung, ihre Kontextes, bisherigen Lernens. Ein solches Konzept von Kindorientierung ist viel zu einfach und leitet die Lehrenden auch in die Irre. Es unterstellt, als wäre es den Kindern selbst aufgegeben, aus eigenen Ressourcen alles zu erreichen und unterschätzt die Solidarität der Lehrenden und Mitlerner, die heute benötigt wird, um Lernen als Chance umfassend auch für benachteiligte Lerner zu entwickeln. Wenn man die mitunter recht euphorischen Beschreibungen bei Vertretern des Offenen Unterrichts liest, dann entsteht der Eindruck, dass hier Kinder aus behüteten Elternhäusern mit hoher Eigeninitiative zu einem Standardmodell des Verhaltens erhoben werden, aber nicht hinreichend erkannt wird, dass man damit bereits selbst einer vereinfachenden Konstruktion zum Opfer gefallen ist.
Die bisherigen empirischen Forschungsergebnisse zum Offenen Unterricht (vgl. unter Darstellung 4.6) zeigen auf, dass die praktische Realisation dieses Konzeptes in „Reinform“ selbst in der Grundschule sehr schwierig ist. Es gibt verschiedene Phasen und Verläufe der Öffnung, wie immer wieder festgestellt wird. Damit wird ein Grundproblem von Unterrichtsreformen bezeichnet: Es kommt vor allem auf die Haltung der Lehrenden und Lernenden an, ihr Lernen neu und passend zu konstruieren. Hierbei kann ihnen die Vision einer Öffnung helfen, aber zur Begründung ihrer Haltung und zur Konkretisierung ihrer Vorhaben werden sie auch mehr als eine Öffnungsvorstellung und mehr als das Angebot dieses Konzeptes benötigen. Didaktische Arbeit setzt, dies als kritische Anmerkung gegen die doch eher oberflächlich begründeten Ansätze Offenen Unterrichts, sowohl eine größere Tiefe als auch eine Perspektivenerweiterung voraus, wie sie derzeit deutlicher in der Breite und Vielfalt sozial-kognitiver und konstruktivistischer Lerntheorien gefunden werden kann. Warum die Vertreter des Offenen Unterrichts sich hiermit nicht stärker auseinandersetzen liegt offensichtlich in dem noch zu ausgeprägten „Meisterlehrerverhalten“, das diesen Ansatz bis heute prägt und in einer vereinfachten Reformpädagogik „vom Kinde aus“, die dem Ansatz enge Grenzen der Begründung aufnötigt. |